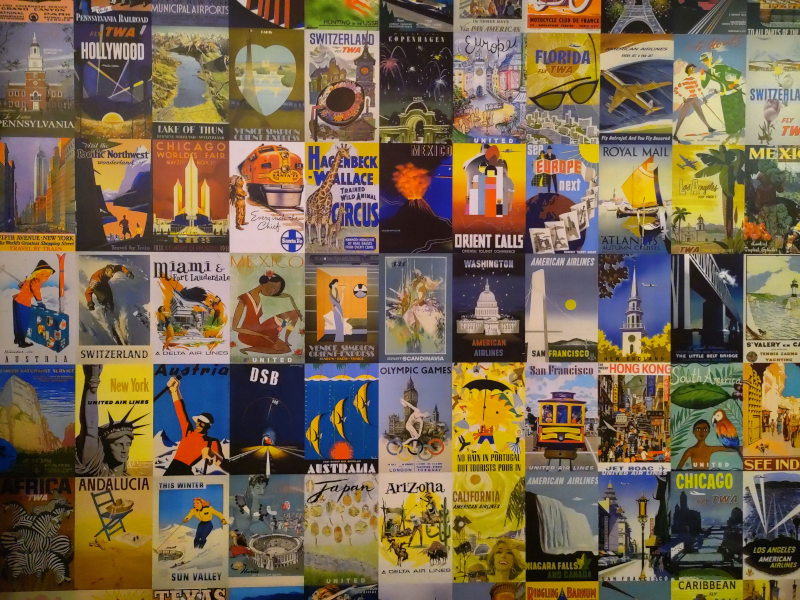Wenn was runterfällt…
Über Objekte, die Geschichten sammeln
We may realize
that people are merely dreams:
the house abandoned,
its wild garden becomes home
to a swarm of butterflies.
Iio Sōgi (1421–1502) übersetzt von David Bowles1
Die Teeschale.
Im 15. Jahrhundert übernimmt Ashikaga Yoshimasa als der achte Shōgun die Herrschaft über das Ashikaga-Shogunat. Sein Interesse für Zen-Buddhismus und die Implementierung dessen Ideale in Ästhetik führt zu architektonischen Leistungen und kulturellen Institutionen die die japanische Kultur in vieler Hinsicht bis heute prägen. Vor allem Techniken wie die japanische Teezeremonie (chadō), Blumenarrangieren (ikebana), das Nō-Theater und die Tuschemalerei (sumi-e) werden unter ihm entwickelt, gefördert und verfeinert. Der Stil, der sich dabei herausbildet wird heute unter dem Begriff der Higashiyama Kultur zusammengefasst: „Much of what is commonly seen today as Japanese Zen aesthetics originated in this period.“2
Als durchdringendes Konzept liegt dieser Entwicklung die aus dem Zen-Buddhismus stammende Idee wabi-sabi zugrunde. Eine Übersetzung, wenngleich nicht einfach, führt notgedrungenerweise zu einer tieferen Auseinandersetzung: Wabi bezeichnet die Schönheit des Einfachen, die Betonung des Schlichten, ein genügsames In-sich-Ruhen3. Während sabi stellenweise mit „Rost“ übersetzt wird und vielleicht eher eine Schönheit beschreibt, die in den Spuren des Alterns, der Verwitterung gesehen werden kann.
Wabi-sabi ist ein ästhetisches Konzept, das im Widerstand zu Prunk und Pomp entsteht und die Betrachter*in zum Innehalten einlädt, zur Wertschätzung einer authentischen Einfachheit, die sich bereits in den Materialien widerspiegelt, deren ästhetischer Wert sich durch die Spuren ihrer Benutzung aber noch steigert. In den Abnutzungsspuren werden nicht nur die hochwertigen Herstellungstechniken deutlich, der praktische, weltliche Nutzen der Gegenstände trägt auch zu ihrer Schönheit bei.
Eines Tages zerbrach, so erzählt man sich, Ashikaga Yoshimasa seine liebste Teeschale. Die Option eines Neukaufs schien ihm unangemessen, nicht aber, die Scherben nach China zu verschiffen, um sie dort fachmännisch reparieren zu lassen. Als die Schale zurückkommt, ist er von den groben Restaurierungsbemühungen enttäuscht und bittet einen japanischen Handwerker darum, sich der Sache anzunehmen. Dieser verklebt die Bruchstücke mit Naturlack (urushi), dem er Goldstaub hinzufügt und stellt damit nicht nur den Shōgun zufrieden, sondern legt damit den Grundstein für kintsugi, die japanische Tradition der Keramikreparatur.
Abgesehen davon, dass die golden hervorgehobenen Bruchlinien wabi-sabis Streben nach anspruchsloser Eleganz wohl nicht ganz entsprechen, gibt es auch sonst Anlass zum Zweifel am Wahrheitsgehalt dieser Geschichte4. Tatsächlich ist sogar die angesprochene, wiederhergestellte Schale nach wie vor erhalten – mitsamt den zur Reparatur benutzten Metallklammern5. Die technischen Voraussetzungen für kintsugi, soll es allerdings zur Regierungszeit des achten Shōgun bereits gegeben haben, während die konkreten Ursprünge der Technik weitgehend im Dunklen liegen.
Nichtsdestotrotz lassen sich in kintsugi die Kerngedanken von wabi-sabi deutlich machen: die Einzigartigkeit des ursprünglichen Gegenstandes und die Wertschätzung für diesen, bei gleichzeitig Ablesbarkeit seines Alters, seiner Geschichte. Im Fall von kintsugi ein Bruch, ein Unfall, ein Moment der Unachtsamkeit, der in den Gegenstand eingeschrieben ist, als sichtbare Erinnerung6.
Der Bierdeckel.
Am 16. Februar 2025 treffen sich mit Olaf Scholz, Robert Habeck, Friedrich Merz und Alice Weidel vier Kandidat*innen für das Amt der deutschen Bundeskanzler*in im RTL Studio Berlin-Adlershof zum Quadrell. Es moderieren Pinar Atalay – die Deutsche mit Migrationshintergrund (15%)7, deutsche Frauen (51%)8 und deutsche Bevölkerung unter 60 (70%)9 repräsentiert – und Günther Jauch. Es wird eine ausführliche, teils lebhafte Diskussion über rechtsradikale Identitäten, die Taliban als Gesprächspartner und dem Dschungelcamp als Alternative zur deutschen Regierungsmannschaft.
An einer Stelle konfrontiert Günther Jauch den späteren Wahlgewinner Friedrich Merz mit einem musealen Objekt: einem Bierdeckel, auf dem dieser 2004 seine Vorschläge zur Vereinfachung des deutschen Steuersystems beispielhaft zusammengeschrieben hatte. Die Idee wirkt dem CDU-Vorsitzenden im RTL Studio zwar auch zu undifferenziert für die aktuelle Lage, aber der Bierdeckel an sich sorgt für Freude unter den Studiogästen.
„Ich muss hier sehr vorsichtig sein, es ist aus dem Haus der deutschen Geschichte und mir ist gesagt worden, diesen Bierdeckeln darf ich selber nicht anfassen, weil’s eben ein Museumsstück ist…“, hört man Günther Jauch, als er das besagte Artefakt10 vorsichtig auf einer Plastikhalterung auf sein Pult hebt. Die Autorität des Musealen ist hier hörbar: Dies ist ein Stück Geschichte, das es für die Zukunft zu bewahren gilt.
Friedrich Merz hatte das Steuersystem-auf-dem-Bierdeckel medienwirksam für einen Foto-Reporter der Deutschen Presse Agentur angefertigt, der wiederum hatte das Objekt 2012 der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vermacht11, die sich mit der deutschen Geschichte nach 1945 beschäftigt. Er fand Eingang in die Sammlung des Haus der Geschichte Bonn, als ein Zeitdokument der politischen Diskussion der ersten Jahre nach der Jahrtausendwende.
Etwas später reagiert Günther Jauch aus dem Off auf die verwirrten Blicke von Pinar Atalay mit einem „nicht petzen“12. Der Bierdeckel war dem Moderator noch während der Live-Übertragung der politischen Diskussionsrunde auf den Boden gefallen. „Die Umgebung war sehr sauber, das sah nach frisch verlegtem Teppichboden aus“13, zitiert die Süddeutsche Zeitung später den Direktor des Haus der Geschichte, Harald Biermann.
Das Haus der Geschichte schätzt sich glücklich, in einer Fernsehveranstaltung wie dem Quadrell der vier Spitzenkandidat*innen einen Auftritt zu bekommen. Im Spannungsfeld zwischen Vermitteln und Bewahren, liegen die Prioritäten deutlich auf Seiten der Möglichkeit, über den Fernsehauftritt auch traditionell museumsferne Personengruppen zu erreichen: „Geschichte werde von Menschen gemacht, und dazu gehörten manchmal auch unvorhergesehene Situationen und Pannen. ‚Der Bierdeckel steht damit zukünftig nicht nur für das Thema Steuerpolitik, sondern auch für den Bundestagswahlkampf 2025‘, so Biermann.“14
Spuren der Vergangenheit.
Die Ursprünge des Museums liegen bekannterweise eng von den Wurzeln des modernen Nationalstaats umschlungen im frühen 19. Jahrhundert15. Das Museum hilft, die bürgerliche Identität der Gegenwart zu formen und schafft dabei – auf Nummer sicher – auch gleich die nationale Vergangenheit, die bereits unvermeidlich auf den gegenwärtigen Moment hinweist16. Das Museum schafft Fakten und stellt dabei Handwerkliches, Künstlerisches wie auch Gegenstände der Natur in den Dienst der nationalen Entstehungsmythologie17.
Der gesellschaftliche Wandel hat den Nationalmuseen weitgehend ein Ende gemacht, die Eindeutigkeit der Objekte wird – auch gegen Widerstände – in Frage gestellt, so bleiben Bedeutungen umstritten, wenn nicht umkämpft18. Insofern möchte man Boris Grojs widersprechen, wenn dieser radikal zwischen der Sammlung von Kunstgegenständen und jener historischer Objekte unterscheidet: „Alle Museen, nur nicht die Kunstmuseen, sind Friedhöfe der Dinge: Was dort gesammelt wird, ist seiner Lebensfunktion beraubt, also tot. Das Leben des Kunstwerks beginnt dagegen erst im Museum.“19 Auch die historischen Objekte unterliegen einer ständigen Interpretation und verändern so auch ihre Bedeutung.
Über ihren ideellen Wert hinaus sind die Objekte aber auch ihrer Körperlichkeit unterworfen, sie nehmen Raum ein, sie altern, sie fallen auch einmal zu Boden. Gerade dort, wo die Objekte auch erforscht werden, bleiben diese ja gewissermaßen auch in Verwendung. Und die wissenschaftliche Auseinandersetzung gehört nun einmal ebenso zum musealen Selbstverständnis, wie sie zu sammeln und sie zu bewahren20: „We should then not assume that objects and their meaning are frozen once they join a collection. The museum was not a static mausoleum but a dynamic mutable entity where specimens were added and preserved, discarded and destroyed.“21
In die Teeschale von Ashikaga Yoshimasa – in die reale, aber auch in die fiktive – haben sich die Spuren der Geschichte deutlich eingeschrieben. Kintsugi hebt die Brüche hervor, anstatt sie zu vertuschen und sieht darin die Objekte aufgewertet, die nicht nur durch ihre Kunstfertigkeit, ihre Schönheit bestechen sondern auch durch die Zurschaustellung ihrer Narben. Ähnlich hat auch der Bierdeckel durch sein Abenteuer im RTL-Studio an Komplexität gewonnen. Die Finger Günter Jauchs – ein Profi, den wir als über Schweißausbrüche erhaben annehmen möchten – dürfte kaum sichtbare Spuren auf dem Untersetzer hinterlassen haben. Und doch hat in einem neuen Kontext, gegenüber einem neuen Publikum neue Bedeutungen angesammelt.
Museale Objekte führen also auch in der Sammlung ein Leben. Sie sind Veränderungen, Bedeutungsverschiebungen, Unfällen und Restaurierungen unterworfen22. Sie sind Gegenstand von Auseinandersetzung und stehen in vielfältiger Beziehung zu Forschenden und Besucher*innen23, denn „[v]isitors were not vessels waiting to be filled but autonomous agents with their own agendas.“24 All diese Beziehungen und Erfahrungen kommen in einzelnen Objekten zusammen, von all diesen Bedeutungen können die Gegenstände letzten Endes auch erzählen. Die Herausforderung bleibt, sie diesbezüglich zum Sprechen zu bringen.
Der vorliegende Text wurde im März 2023 als 1. Semesterarbeit im /ecm Lehrgang 2024-26 an der Universität für angewandte Kunst, Wien eingereicht. Mein Dank gilt dabei Christine Haupt-Stummer, die die Arbeit betreut und unterstützt hat. Zur besseren Lesbarkeit wurde der Text formal geringfügig überarbeitet.
Quellenangaben.
1Bowles, David: “Dream People” by Monk Sōgi (21. April 2014), https://davidbowles.us/poetry/translations/dream-people-by-monk-sogi/ (3. März 2025).
2Wikipedia: Higashiyama Culture (5. September 2024), https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Higashiyama_culture (3. März 2025).
3Wadokudaijiten. Japanisch-Deutsches Wörterbuch, Band 3: wabi (2022),https://www.wadokudaijiten.de/wb/band3.php?q=wabi&m=l&r=0&c=10&id=wabi (3. März 2025).
4Sansho: Kintsugi: Fact and Fiction (2. Dezember 2021), https://sansho.com/blogs/news/kintsugi-fact-and-fiction (3. März 2025).
5National Institutes for Cultural Heritage: Celadon porcelain bowl, named Bakōhan, https://emuseum.nich.go.jp/detail?langId=en&webView=null&content_base_id=100886&content_part_id=001&content_pict_id=008 (3. März 2025).
6Amy PRICE, Commentary: My Pandemic Grief and the Japanese Art of Kintsugi, in: BMJ, 2021, 374, n1906. https://doi.org/10.1136/bmj.n1906.
7Statistisches Bundesamt: Bevölkerung nach Migrationshintergrund und Geschlecht, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/migrationshintergrund-geschlecht.html (3. März 2025).
8Statistisches Bundesamt: Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/deutsche-nichtdeutsche-bevoelkerung-nach-geschlecht-deutschland.html (3. März 2025).
9Statistisches Bundesamt: Bevölkerung nach Altersgruppen, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/bevoelkerung-altersgruppen-deutschland.html (3. März 2025).
10Stiftung Deutsches Historisches Museum: LeMO Objekt: Bierdeckel mit Entwurf ‚Vereinfachte Steuererklärung‘ von Friedrich Merz, https://www.hdg.de/lemo/bestand/objekt/archivgut-bierdeckel-steuererklaerung-merz.html (3. März 2025).
11Rausch, Thore und Georg Ismar: Quadrell-Fauxpas. Kriegt Jauch nun eine auf den Deckel? Süddeutsche.de (17. Februar 2025), https://www.sueddeutsche.de/medien/quadrell-rtl-bierdeckel-jauch-tv-duell-li.3203543 (3 März 2025).
12@rtl-news: Uuuups! #quadrell #shorts, https://www.youtube.com/shorts/Bzw55J1JSe0 (3. März 2025).
13Rausch, Thore und Georg Ismar: Quadrell-Fauxpas. Kriegt Jauch nun eine auf den Deckel? Süddeutsche.de (17. Februar 2025), https://www.sueddeutsche.de/medien/quadrell-rtl-bierdeckel-jauch-tv-duell-li.3203543 (3 März 2025).
14Deutsche Presse-Agentur (dpa): Panne in TV-Vierer-Runde. Museumschef: Merz’ Bierdeckel unbeschädigt, Süddeutsche.de (17. Februar 2025), https://www.sueddeutsche.de/kultur/panne-in-tv-vierer-runde-museumschef-merz-bierdeckel-unbeschaedigt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-250217-930-377523 (3. März 2025).
15Benedict ANDERSON, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Revised edition, London New York 2016.
16Tony BENNETT, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics, Reprinted, Culture, London 2009.
17z. B. Donna HARAWAY, Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden, New York City, 1908-1936, in: Social Text, Nr. 11, 1984, S. 20-64. https://doi.org/10.1515/9780691228006-004.
18z. B. Henrietta LIDCHI, The Poetics and the Politics of Exhibiting Other Cultures, in: Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, 3rd edition, London 2025, S. 151–222.
19Boris GROJS, Logik der Sammlung: am Ende des musealen Zeitalters, München 2009, S. 9.
20International Council of Museums: Museum Definition, https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/ (3. März 2025).
21Samuel ALBERTI, Objects and the Museum, in: Isis 96, Nr. 4, Dezember 2005, S. 559-571. https://doi.org/10.1086/498593. S. 567.
22z. B. Pandora KÖHLER, Altrestaurierungen erzählen Geschichte(n): 160 Jahre Methoden und Akteur*innen in der Majolikasammlung des Museums für angewandte Kunst Wien, Wien, WS 2024/25.
23vgl. Nora STERNFELD, Das radikaldemokratische Museum, Berlin Boston 2018, S. 113–22.
24Samuel ALBERTI, Objects and the Museum, in: Isis 96, Nr. 4, Dezember 2005, S. 559-571. https://doi.org/10.1086/498593. S. 569.