Ich glaub, Neuseeland ist eine zweite Vogelfolge wert. Immerhin waren Vögel ja die dominante Lebensform, bevor die ersten Menschen ihre Fußstapfen in den Sand getreten haben. Und erst die Europäischen EinwandererInnen (Pākehā) haben ihre Säugetiere mitgebracht: Den einen haben sie die einheimische Flora großflächig umgestaltet, nämlich Schafen und Kühen – für die ganze Landschaften mit europäischen Gräsern bepflanzt wurden –, die anderen haben von sich aus die vorhandene Fauna aufgemischt. Letzteres in erster Linie Ratten, Mäuse, Katzen, Hunde, Opossums, Frettchen und Marder. Und weil die neuseeländischen Vögel zum Teil nicht einmal ihre Nester in den Bäumen gebaut haben, haben sich eingeschleppten Allesfresserchen und die ihnen nachgeschleppten Jäger über das Federvieh hergemacht, dass es buchstäblich die Hälfte auch getan hätte.

Und weil der Mensch lernt oder zumindest angesichts der ausgerotteten Tier- und Pflanzenarten eine gewisse Reue an den Tag legt, versucht man heute, Reservate zu schaffen, zu denen die Vögeltöter keinen Zugang haben. Das Paradebeispiel ist die Geschichte von „Old Blue“, die Anfang der Achtziger das letzte Weibchen einer kleinen Vogelart (Petroica traversi) auf Chatham Island war und die, dank enormer Bemühungen, zur Stammmutter von heute etwa zweihunderfünfzig Chatham-Schnäppern wurde. Das gelingt weil Neuseeland ja viele Inseln ist, die mehr oder weniger gut kontrollierbar sind und da macht man ein Reservat quasi nach dem anderen und schafft den Vögeln dort Lebensraum. Und sie ist man in Neuseeland auch durchaus stolz auf die lokale Vogelwelt, die ja doch in vieler Hinsicht was besonderes, was eigenes und was herausragendes ist. Quasi: die Beuteltiere Neuseelands. Und man kann dementsprechend kaum irgendwo um die Ecke gehen, ohne irgendwo schemenhaften Kiwiabbildungen gegenüberzutreten.
Einer der imposantesten und sicherlich für die frühe Besiedelung durch die Māori nicht unwesentlichen Vögel, ist der Moa (Dinornis). Zur (unmerklichen) Schonung des gesamteuropäischen Karmas, waren sie leider schon ausgestorben, bevor Abel Tasman hier sechzehnzweiundvierzig seinen europäischen Fuß an Land gesetzt hat. Ach, hätten wir doch bloß heute noch eine Handvoll Moas bei der Hand, würde die ganze Diskussion über die Lächerlichkeit gefiederte Dinosaurier nur ein halbes Gespräch und einen deutlichen Fingerzeig dauern. Ein drei Meter großer Vogel mit Horrorklauen sollte jedeR SkeptikerIn zumindest das lächerliche Argument des „gefiederten Huhns“ entkräften.

Im Museum von Christchurch lerne ich, dass man Moas heute in sechs bis neun Arten unterscheidet, die aber allesamt vor vierhundertfünfzig Jahren ihre jeweils letzten Eier gelegt haben. Interessant ist außerdem, dass wie so oft Unklarheit über die Verwandtschaftsverhältnisse besteht. Ich höre immer wieder, dass die nahen Verwandten der Moas die Kiwis und der Strauß sind. Und ich stelle mich und meine Behauptungen einmal mehr auf die wackeligen Beine, eines welchen, der sich in seinen Quelle auf Wikipedia beschränkt: Die nächsten Verwandten der Moas, so sagt man heute, wohnen in Mexiko und nennen sich Steißhühner (Tinamiformes). Das Lesen des Artikels macht sich vor allem für jene bezahlt, die gerne ihr Wissen über ausstülpbare Vogelpenisse erweitern möchten. Hingegen sind Kiwis, Emus, Kasuare und gar der Vogel Strauß, eher Cousinen als genetische Geschwister der Moas.
Die ersten Tage in Neuseeland bekomme ich außer den allgegenwärtigen Stockenten (Anas platyrhynchos) ehrlicherweise nicht viele Vögel zu Gesicht. Vielleicht, dass ab und zu einmal einem Paradieskasarka begegne, der auf Māori Pūtangitangi (Tadorna variegata) heißt. Ein Kasarka, das ist im Wesentlichen etwas zwischen Gans und Ente. Die Weibchen sind mit ihrem weißen Kopf eher die auffälligen, wohingegen mir die dunkel gehaltenen Männchen mir wahrscheinlich kaum aufgefallen wären. Wenn also überhaupt, dann hab ich wohl mal ein vereinzeltes Pärchen gesehen oder was. Meine erste größere Gruppe hab ich am Strand von Oban auf Rakiura (Steward Island, aber ich hab so lange gebraucht, bis ich mir den Māori Namen gemerkt hab, dass ich den jetzt verwende) gesehen, dort sind sie gemeinsam am Spielplatz gelegen, bevor sie sich daran gemacht haben, vom Rasen zu naschen.

Dann ist mir ein Purpurhuhn namens Pūkeko (Porphyrio melanotus) über den Weg gelaufen. Die sind, wie ich lerne, bekannt für ihre Hinterhältigkeit, zumindest in der Māori Mythologie. Nachdem ich jetzt ein bisschen darüber nachgedacht hab und mir das von der Verbreitungslandkarte bestätigen habe lassen, werde ich mein erstes Pūkeko wohl noch im botanischen Garten in Melbourne gesehen haben. Das hat bei mir schon Faszination ausgelöst, weil schön sind die eigentlich nicht, aber halt doch fantastisch, kann ich mir nicht helfen. Mittlerweile hab ich auch hier das eine oder andere rumstaksen gesehen und ich mag die Rumstaksevögel ja gern.

Tatsächlich in Neuseeland habe ich einen Gelbaugenpinguin (Megadyptes antipodes) gesehen. Einen. Das war in Oamaru und ich hab mir einen Sonnenbrand dabei geholt. Zuerst waren wir auf der Suche nach den Zwergpinguinen (Eudyptula minor), aber für die haben sie Eintritt verlangt. Und für beide Pinguinarten hat gegolten, dass sie tagsüber im Meer unterwegs sind und am Abend nachhause kommen um sich in ihren Höhlen zu verstecken. Wir sind dann über den Berg drüber geklettert – mehr ein Hügel tatsächlich, darauf hat die Innsbruckerin bestanden – um auf der anderen Seite den Strand der Gelbaugenpinguine zu finden. Was wir dort gefunden haben waren Paua Muscheln und ich habe in der Elster (Pica pica) mein Totemtier entdeckt: Ich hab s einfach nicht geschafft, diese Muscheln liegen zu lassen, und es ist wirklich mehr gewesen, weil sie so hübsch perlmuttern schimmern. Ein gutes Dutzend hab ich gesammelt, wie Römerhelme ineinander gestapelt und bald einen parallel laufenden, internen Konflikt aufgerissen, weil es gibt nichts wenig unsinnigeres, als beim Backpackern Muscheln mit sich herumschleppen. Ich sammel ja auch regelmäßig mal Federn auf, aber die sind wenigstens von berufswegen leicht und selbst die schmeiß ich regelmäßig weg, wenn ich wo eine finde, die ich nicht mehr zuzuordnen weiß. Gerade für die Paua Muscheln gibt es ja als warnendes Vorbild jenes ältere Paar, das ganze Haus voll hatte, das sie dann nach Christchurch ins Museum gestellt haben. So hab ich wenigstens immer vor Augen gehabt, wohin das führen würde, sollte ich nicht in der Lage sein, die Dinger liegen zu lassen. Letzten Endes hab ich zuerst ein paar und dann die anderen auch noch liegen gelassen. Und die eine, die ich seit dem bei mir trage, stinkt so sehr, dass ich sie eh öfter bereue als nicht. In den Bergen hab ich die Gelegenheit, das ganze Hostel für mich selbst zu haben, einmal genutzt, um sie auszukochen. Aber nach dem vierten Mal hat sich immer noch nicht allzu viel getan, bis auf dass die Außenschale jetzt hässlich ist.

Am Gelbaugenpinguinstrand haben wir außerdem einen Haufen Seehunde Seelöwen (Phocarctos hookeri) angetroffen, die gerade dort in der Sonne herumliegen. Angeblich sind die auch am Land mitunter schneller als ich, aber das hab ich erst nachher gelernt und zweifle ich seit dem auch an. Es ist einfach schwer vorstellbar, dass Tiere, die so gut in Gemütlichkeit zu sein scheinen, insgeheim SprinterInnen sein sollten. Was sie auf jeden Fall haben, sind ziemliche Klauen an den Hinterbeinen. So nah dran waren wir dann doch. Hätten wir nicht sein sollen, hat die Dame uns gesagt, die um dreiviertel Vier gekommen ist um uns zu sagen, dass wir seit halb eigentlich nicht mehr da sein sollten. Weil nämlich: wenn die Pinguine sich nicht sicher fühlen, dann kommen sie einfach nicht nachhause. Und das sind sie dann auch nicht, zumindest nicht innerhalb der neunzig Minuten, die wir in der Nachmittagssonne gestanden sind, über die faulen Robben Seelöwen lästernd, denen wir die vermeintliche Angst der Pinguine in die Schuhe geschoben haben.

Wirklich mit den Vögeln hat es dann erst auf Rakiura angefangen. Rakiura ist im Süden von Neuseeland, die „dritte Insel“, wie einige Lustige sagen, aber viele dürften das nicht sein. Insgesamt wohnen nicht einmal vierhundert Leute in Oban, dem einzigen Ort der Insel, kaum sechshundert insgesamt auf der Insel. Dafür gibt es aber große Bemühungen, den Ratten, Opossums und was sonst noch am Vogeltöten und Eierpecken ist, auf der Insel den Garaus zu machen. Ich war etwas überrascht, dass es im Supermarkt so viel Katzenfutter zur Auswahl gab, aber hey!, sollen sie zumindest gut gefüttert sein, vielleicht gehen sie dann weniger auf die Vögelchen.
Der erste Vogel, dem ich auf meiner Dreitageswanderung begegnet bin, war ein Tūī (Prosthemadera novaeseelandiae). Und eigentlich hab ich ihn zuerst gehört und erst dann gesehen. Der Tūī ist ein Honigfresser, die kennen wir noch aus Australien. Und er hat – sehr witzig – ein weißes Federbüschel am Hals hängen, bisschen wie ein aufwendiges Mascherl. Und er singt ausgiebig und eindrucksvoll. Ich bin vor dem Baum gestanden, in dem er auf und ab gehüpft ist und war natürlich ganz hin und weg: drei Tage Wanderung vor mir und dementsprechend viel Energie, Enthusiasmus und Trockenheit in den Schuhen. Da ist jedes Naturerlebnis gleich noch einmal so erlebnisreich.
Auf Māori Beach bin ich dann meinen ersten Austernfressern (Haematopus finschi) begegnet. Nachdem auch diese Vögel Staksen zu ihrer vornehmlichen Fortbewegungsmethode ausgewählt haben, sind sie mir natürlich von vornherein nah am Herzen. Außerdem haben sie einen sehr roten Schnabel und ein im Vorbeigehen durchaus beobachtbares Sozialleben. Während ich ihnen zugeschaut hab, ist der eine eindeutig dem anderen ständig leicht unterwürfig hinterhergelaufen, hat nie den Schnabel in den Sand gesteckt, wo nicht zuerst der andere schon gebohrt hatte. Und dann ist er auch noch lautstark verjagt worden, weil laut können sie auch werden.
Ebenfalls mir bereits aus Australien bekannt ist der Fantail, zu Deutsch kompakt Neuseelandfächerschwanz (Rhipidura fuliginosa) genannt oder halt auf Māori Pīwakawaka. Und die gewinnen fast im Herzigsein. Den ersten hab ich auf einem Parkplatz in Cairns gesehen, wo er minutenlang vor mir auf und ab gehüpft ist und – nomen/omen/etc. – den Schwanz wie ein ganz ein kleiner Pfau aufgefächert hatte und damit hin- und hergewippt hat. Witzig auch, und da ist der neuseeländische nicht viel anders, dass Willie Wagtail (Rhipidura leucophrys – und interessant, weil die wagtails sind eigentlich Stelzen, der Name also nicht nur ein fahrlässiger Ausflug in den Kolloquialismus, eine falsche Zuschreibung auch noch!), wie der australische Fächerschwanz heißt, auf dem ansonsten dunklen Kopf deutliche weiße Streifen über den Augen hat. Wie man vom Orca und dem Marienkäfer weiß, verwechselt man dadurch leicht einmal, wo tatsächlich die Augen sind und es gibt ihm eine gewisse, wie ich finde, Strenge. Vielleicht sehe ich mehr buschige Augenbrauen als Augen…
Auf Rakiura gibt es dann noch – ich bin ganz offenbar in der Herzigkeitsabteilung der neuseeländischen Vogelwelt gelandet – den South Island Robin (Petroica australis). Und jetzt reicht s mir schon langsam mit den blöden deutschen Namen! Weil, natürlich war ich jetzt gespannt, wie der bei uns genannt wird, nachdem ein Robin ja ein Rotkehlchen ist. Und man sieht ihm natürlich sofort die Ähnlichkeit zu unserem Rotkehlchen an, auch wenn ihm die bezeichnende Kehlchenfarbe fehlt. Und ja, auf deutsch wird er Langbeinschnäpper genannt. Unsexy! Aber korrekt. Weil wie uns Wikipedia.de lehrt (ja, übrigens, wider den Uploadfilter und all das!), dass „[d]ie Schnäpper […] nicht […] mit den auch in Europa verbreiteten Fliegenschnäpper [zu denen das Rotkehlchen gehört, Anm.] (Muscicapidae) [zu verwechseln sind], mit denen Sie [sic!] nur fern verwandt sind.“

Auf jeden Fall hatte ich einige sehr nette Begegnungen mit – nennen wir sie bei ihrem Māori Namen – Kakaruai. Insbesondere auf Ulva Island, wo ich nach meiner Dreitagstour einen Ausflug hingemacht hab. Da hat uns schon der sympathische Skipper Peter darauf aufmerksam gemacht, dass, wenn wir uns langsam bewegen, regelmäßig stehenbleiben auf unseren Spaziergängen, dann kämen die Vögel zu uns, weil sie in uns eine Nahrungsmittelquelle sehen. Und sie seien nicht hinter unserem lunch her, sie sind hinter den Insekten her, die wir aufscheuchen, wenn wir beim Gehen den Boden aufwühlen. Das war dann auch so, dass da einmal drei kleine Kakaruai um mich herum gehüpft sind und hinter mir im Boden gepickt haben. Natürlich ist jede Bewegung zu viel und der Griff nach der Kamera ist unmöglich, ohne sie zu verjagen. Insofern steh ich dann und schau und freu mich. Eine Führerin hat etwas später einen Kakaruai angelockt, indem sie diese Zigaretten-austreten-Bewegung gemacht und damit ein leckeres Würmchen freigelegt hat.
Auf dem Boot in Richtung Ulva Island kann man schon aus einer gewissen Distanz die Māori-Fruchttaube oder Kererū (Hemiphaga novaeseelandiae) erkennen, die in hohen Bögen aus dem Wald herausfliegt und sich dann wieder in denselben fallen lässt. Ich hab keine Ahnung, was sie dabei machen… Auf der Wanderung ist mir allerdings einmal eine mitten am Weg gesessen. Riesiges Ding. Wir schauen uns kurz an, bevor sie sich auf den nächsten Baum gehievt hat. Dabei wirkt sie wahnsinnig sauber. Weil halt weiße Federn machen schnell einmal den Eindruck, dass es sich umein besonders sauberes Tier handelt und dann der bunt schillernde Kopf, auch ziemlich cool. Sie machen ein ziemlich lautes Geräusch beim Fliegen, wobei ich mir nicht ganz einig war gemeinsam mit einem fellow Tourengeher, ob sie das Geräusch einfach mit den Flügel machen oder tatsächlich irgendwie aus dem Schnabel heraus.

Nachdem mich der Mitwanderer eines Abends auf die Geräusche einer Eule aufmerksam gemacht hat, die wir allerdings nur zu hören bekommen haben, bin ich natürlich versucht, ihm zu glauben, dass das tatsächlich ein Laut ist, den die Taube macht. Andererseits gibt s nur eine Eule in Neuseeland und dass da draußen eine Eule zu hören war, das hätte ich vielleicht auch knapp so erraten. Allerdings nennen sie ihre Eule Morepork (Ninox novaeseelandiae), was sie onomatopoetisch erklären. Ist interessant, weil man möchte das ja gerne für indigene Namen annehmen, aber die Māori nennen sie Ruru. Mit etwas Fantasie und wenn man sich nicht abends über einen Vogel amüsieren möchte, der mehr Schweinefleisch verlangt, dann geht sich für Ruru allerdings auch eine mehr oder weniger onomatopoetische Erklärung aus. An ihrem deutschen Namen lässt sich dann auch erkennen, dass es sich natürlich gar nicht um eine Eule sondern um ein Kauz handelt. Einen Neuseeland-Kuckuckskauz. Und jetzt halt dich fest: „Sein tiefer zweisilbige [sic!] Ruf ‚buh-buk‘ erinnert an einen Kuckuck.“ Meine like-the-city-Bemerkungist leider von niemandem aufgegriffen worden. „Was bis du für eine software engineer, wenn du deine Scheibenweltreferenzen nicht parat hast?“, hab ich nicht gesagt.
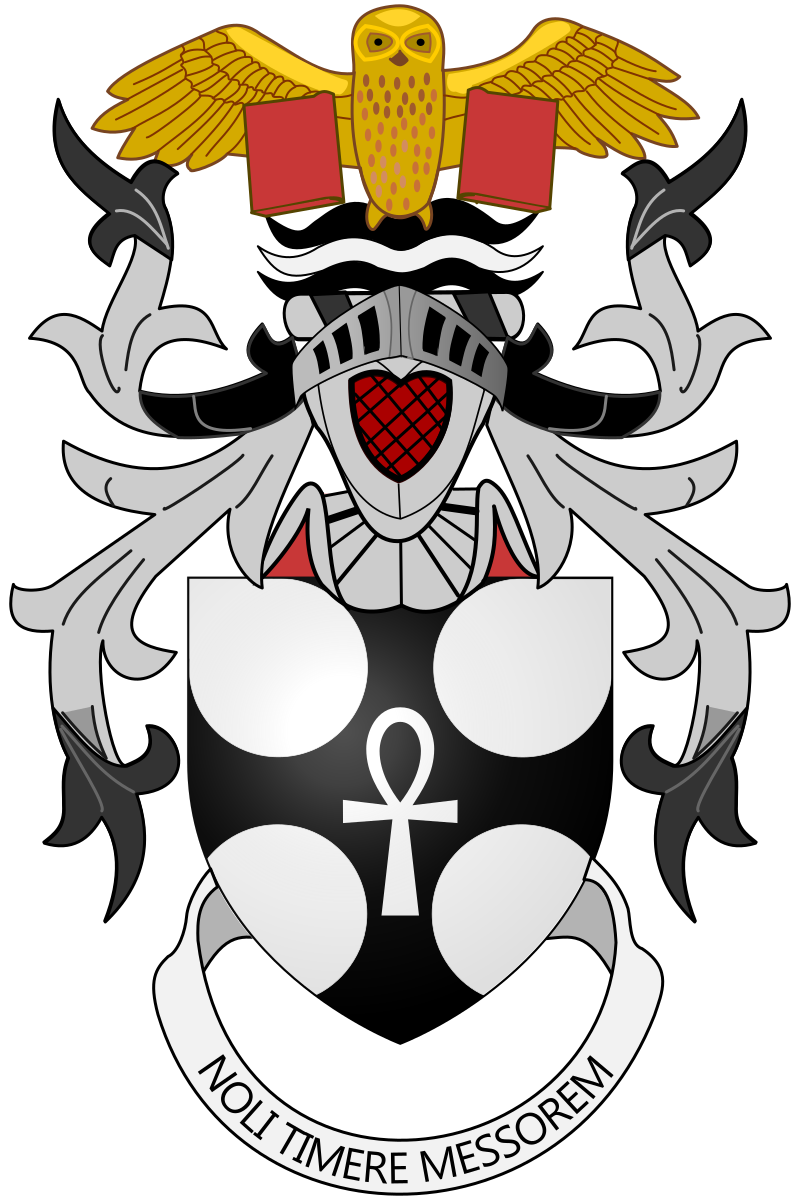
Was wir nicht gesehen haben, ist der Kiwi (Apteryx). Also, ich hab ihn nicht gesehen. Der anstrengende Deutsche hat einen gesehen und vielleicht der eine oder die andere WandererIn ebenfalls. Aber die tragen auch nicht das Attribut anstrengend vor sich her und haben deswegen auch weitgehend ihren Schnabel ob diverser Kiwisichtungen gehalten. Ich hab einen gehört, mitten in der Nacht und in Folge die Hälfte der BettenlagerliegerInnen aufspringend und sich Kiwigeräuschbestätigungen zuraunend erlebt. Aber raus sind tatsächlich nur wenige mit ihren roten Lampen. Und soweit ich das im Halbschlaf mitbekommen hab, haben die auch keine Kiwis erwischt. Ich hab in der selben Nacht ein Reh (Odocoileus virginianus) gesehen, als ich auf einen Sprung meinen Urin raustragen war. Die haben sie dort ausgesetzt, damit die JägerInnen was zu schießen haben. Anschließend hatte ich tagelang Sting im Kopf, weil mein Unterbewusstsein der Meinung gewesen war, dass es unsinnig sei, mit dem roten Licht den Kiwis hinterherzujagen. Letztlich eignet sich Roxanne aber eh schlecht für einen Ohrwurm, so melodiös ist das wirklich nicht.

Während man auf Rakiura auf Schritt und Tritt Rattenfallen findet, ist es auf Ulva Island bereits gelungen, die Jäger auszurotten und deshalb ist das dort ein ziemliches Paradies für Vögel. Es ist nicht ganz so abgesichert, wie Codfish Island, das westlich von Rakiura liegt. Dort gibt es eine von zwei übriggebliebenen Kākāpō Populationen (Strigops habroptila). Ich habe ähnliche Sicherheitsvorkehrungen für Ulva erwartet, aber letztlich war ich nicht unglücklich, dass außer dem Hinweis, dass wir bitte unsere allfälligen Ratten auf Rakiura lassen sollen, keine besonderen Maßnahmen getroffen wurden. Ich hab sogar einen Apfel mitgehabt, obwohl wir auch keine Samen auf die Insel mitnehmen sollten. Aber dann wiederum lässt sich aus einem Industrieapfel wohl eh kaum ein echter Setzling ziehen, oder irr ich mich? Vorauseilend wie eh und je habe ich den Apfel jedoch unangebissen wieder zurückgebracht.
Auf Ulva hab ich noch eine Wekaralle oder einfach Weka (Gallirallus australis) gesehen. Kann man leicht mit einem Kiwi verwechseln und so lange hab ich mich dann doch damit beschäftigt, der Weka beim Baden zuzusehen, um ihren Schnabel ins Bild zu bekommen – in meinen Augen der einzige sichere Test, ob es sich nicht doch um einen der dreißig bis vierzig Kiwis handeln sollte, die auf Ulva leben. War nicht. Und dann springt die Weka auf und ratz fatz in den Busch. Und aus dem Geäst fliegt mir ein Kākā entgegen. Oh ja, großer, dunkler Kākā (Nestor meridionalis), der sich eineinhalb Meter mir gegenüber auf einem Ast niederlässt und mich mit seinen schwarzen Augen mustert. Das war schon beeindruckend, irgendwie hatte ich doch ein anderes Gefühl von Intelligenz in Anbetracht dieser Augen, als wenn mich, sagen wir, ein Fliegenschnäpper betrachtet. Ist auch herzig, aber das ist fast eine Begegnung.

Natürlich, der Name, das ist schon schwierig. Auf Rakiura bin ich auf einen Aussichtshügel gestiegen und da kommt mir eine vielleicht Sechsjährige entgegen, die mir mitteilt, dass weiter vorne ein guter Ausblick ist und dass da Bänke sind und ihr Vater. Und ich war gerade dabei, in den Bäumen zwei Kākās zu finden, die ich an ihrem Flügelschlag und Gekrächze dort vermutete. Und in dem Moment seh ich auch den einen und sag zu ihr, dass da oben, also, wenn sie von hier da rauf schaue… Es ist nicht so einfach – insbesondere einem Kind gegenüber – festzustellen, dass da in den Bäumen ein Kākā zu sehen sei. Noch dazu war ich mir zu dem Zeitpunkt gar nicht sicher, ob s da nicht verschiedene Unterarten gäbe, ich dachte, das irgendwo auf einem Poster gelesen zu haben. Und man will ja einer Sechsjährigen keinen Unsinn erzählen. Bin mir nicht ganz sicher, ob sie sie gesehen hat, aber ich bin mit Vater und Tochter am Nachmittag auf der Fähre gewesen und da hat sie auch noch gerne mit mir geplaudert.
Die zwei Kākās in den Ästen über mir waren schon toll, aber natürlich, dass ich zwei Stunden später einem im Wald gegenüberstehen würde, das hab ich mir da noch nicht gedacht. Und es war auch nur ein Moment, weil mit zwei drei Sätzen ist der der Vogel dann von Baum zu Baum gesprungen und so schnell konnte ich mich gar nicht umdrehen ist er auch schon wieder in den Wald entflogen gewesen. Deshalb heißt er wohl auch Waldpapagei.

Im Wald von Ulva hab ich auch noch einen Schwarm Ziegensittiche gesehen, die durch das Geäst geflogen sind, Kākāriki (Cyanoramphus novaezelandiae). Während die Bedeutung des Māori Namens wie die des englischen Namens sich darauf beschränkt, den roten Tupfer hervorzuheben, bezieht sich die deutsche, tendenziell uncharmante Bezeichnung auf ihre Laute, die angeblich an meckernde Ziegen erinnern. Kann ich nicht sagen, ich hab sie wohl bisher nur das eine oder andere Mal auf Bäumen gesehen, hauptsächlich im Flug eigentlich.
Als ich mich schließlich von Rakiura wieder verabschiedet hab, hab ich vom Pier aus noch einen Albatros (Diomedea epomophora) im Wasser schwimmen gesehen und es war ein bisschen eine Epiphanie, was so dieses Größenverhältnis zwischen Möwe und Albatros betrifft. Es war ein bisschen wie den Raben oben an der Devil’s Staircase zu sehen, der mir so deutlich den Unterschied zwischen Krähe und Rabe reingedrückt hat. Der Albatros hat s dem Fischer schwer gemacht, dessen Köder der Albatros sofort hinterher geschwammflattert ist – so mit Hilfe seiner Flügel an der Wasseroberfläche entlanglaufend. Und dann sitzt der Albatros geduldig, bis der Herr Fischer den Köder wieder aus dem Wasser zieht und dann ist er wieder zur Stelle. Als dann ein relativ großer Hai von unter dem Pier hervor geschwommen ist, hat s dem Albatros allerdings schnell gereicht und er hat sich auf weiteres aus dem Wasser erhoben.
Die letzten Beobachtungen hab ich dann in Arthur’s Pass gemacht. Zurückblickend war die Aussicht, dort Keas (Nestor notabilis) zu sehen wohl mindestens zu fünfzig Prozent dafür ausschlaggebend, dass ich mir den Aufwand gegeben habe, dorthin zu kommen. Interessanterweise hab ich noch sehr gut in Erinnerung, wie gleichgültig ich den Keas in Schönbrunn gegenüber gewesen bin, als ich sie dort zum ersten Mal gesehen hab. Sie kommen wohl nicht ganz dorthin, wo meine Papageienerwartungen sie gerne empfangen hätte. Mal angefangen damit, dass sie farblich nicht irrsinnig aufregend sind, leben sie in den Bergen, tun sich auch mit Schnee ok und sie sind am Ende auch noch Aasfresser. Also, wenn sich die Gelegenheit bietet, ich glaube, sie sind sehr opportunistische Esser. In Schönbrunn war dann diese Plakette, wie intelligent sie sind und dass sie zusammenarbeiten, um Probleme zu lösen und all das. Hat mich alles wenig beeindruckt. Aber seit dem hat sich wohl doch einiges getan. Meinem ersten Kea bin ich am ersten Abend über die Straße gefolgt und halb in einen Busch gekrochen, bis ich mir überlegt habe, was allfällige Passanten über mein wirres tun im Halbdunkeln denken mögen. Ich hab den Kea in dem Busch auch nicht mehr gefunden, aber ich nehme an, er ist irgendwo belustigt auf einem Baum gesessen.
Zu hören sind die Keas schnell einmal gewesen, vor allem abends, aber auch tagsüber hat man immer wieder ihre Rufe gehört. Beim Spazierengehen ist dann einmal einer einige Meter über mir vorübergeflogen, so dass ich die rote Musterung an der Flügelunterseite zu sehen bekommen habe. Und am zweiten Abend hab ich dann einen ganzen Schwarm beobachtet. Jemand hatte geschnittene Äpfel auf einem Rasen ausgeschüttet und das ist eigentlich gar nicht ok. Don’t feed the kea!, informieren einen die Schilder. Und wer sich die Mühe macht kann auch die rezente Geschichte eines mit Lebensmittelvergiftung eingelieferten Keas lesen, der glücklicherweise unlängst wieder in die Freiheit entlassen werden konnte.

Für mich war das natürlich trotzdem nicht so schlecht, weil das ein gutes Dutzend Vögel angelockt hatte, die jetzt vor mir durch die Wiese spaziert sind, um sich die besten Apfelstücke herauszupicken. Wiederum am eindrucksvollsten war es, als ein relativ großes Exemplar einen Meter neben mir gelandet ist. Das ist einfach ein witziges Erlebnis, wenn man so mittendrin ist, dass die Vögel auf einen zu kommen oder zumindest einen soweit ignorieren, dass sie einen dann erstaunt, weil ebenfalls entsprechend unerwartet, beäugen.
Bei meinem Spaziergang den Pass entlang war aber vor allem ein Vogel präsent und der zunächst auch mehr über seinen Gesang. Und wer versteckt sich da im Gäst? Der Maori-Glockenhonigfresser (Anthornis melanura). Ein Gefühl für Namen, die deutschen BiologInnen. Vielleicht sollte man das mal den SprachverteidigerInnen unter die Nase halten, dass das Deutsche immer schon weniger auf Ästhetik denn auf Exaktheit Wert gelegt zu haben scheint. Denn immerhin, soviel muss ich ihnen lassen, weiß ich anhand des Namens, dass ich hier wieder einen Honigfresser zu Gesicht bekommen habe. Das weiß ich natürlich bei Bellbird ebensowenig wie bei Korimako, wie er auf Māori genannt wird.
Zwei hab ich noch, abschließend, nämlich aus der Raubvogelkategorie. Da gibt s den Maorifalken (Falco novaeseelandiae) – die oben erwähnten BiologInnen scheinen da wesentlich öfter zum „Maori“ als zum „Neuseeland“ Präfix gegriffen zu haben. Das ist der einzige neuseeländische Falke und damit hab ich sicher ab und zu einen gesehen. Den Blick aus dem Autobus hab ich nämlich immer wieder etwas raubvogelartiges über den Wäldern und Feldern kreisen gesehen. Nie wirklich aus der Nähe, aber vom Verhalten her halt eindeutig Raubvogel.
Leider ausgeschlossen ist, dass ich ihn mit dem Haastadler (Harpagornis moorei) verwechsle, weil der hat sich gemeinsam mit den Moas bereits vor einigen Jahrhunderten aus unserer Welt verabschiedet. Der größte Greifvogel der Neuzeit mit einer Flügelspannweite von drei Metern, bis zu achtzehn Kilo schwer… Eine der Wandernden hat gemeint, think Gandalf. Weil im Gegensatz zum Herrn Pratchett sitzen die Herr der Ringe Referenzen hier ganz locker.








