Wieder ein Flughafen, wieder ein Aufbruch. Diesmal bin ich aber wirklich etwas länger unterwegs und vielleicht ist das auch symbolisch irgendwie. Oder so herum: vielleicht will man da auch irgendwas symbolisches drin erkennen. Immerhin verlasse ich die Tropen, hab ich festgestellt, als ich mir heute Morgen beim Das-letzte-Mal-den-Strand-entlang-Gehen beinahe einen halbseitigen Sonnenbrand geholt hätte. Da setzen sich die Leute echt noch in die Sonne mit ihrer Joghurthaut! Das hat mich wirklich ein bisschen überrascht, dass Leute immer noch dieses Urlaubsbild haben, dass sie sich am ersten Tag mit einem Buch in den Sand setzen müssen. Und die, die sich nicht ganz der Illusion hingeben, dass das an sich eine gute Idee wäre, die schmieren sich eh zentimeterdick mit Sonnencreme ein, dass man die Molke kaum durchschimmern sieht. Man mag darin auch eine Arroganz sehen, weil ich doch seit Monaten unter Palmen schlender und deren ja längst indifferent geworden mögen… habe… sein. Aber ich hebe den Arm und strecke den Finger gen Himmel um das Augenmerk darauf zu lenken, dass ich das vor einem Jahr so ähnlich gesehen hätte. Und in der Tat hab ich kaum jemals Zeit am Strand verbracht und ich würde sogar sagen: das ist das erste Mal seit Australien, wo ich das mal probiert habe und dann wieder raus bin, weil ich das Meer ganz allein plötzlich als unheimlich empfunden habe, das erste Mal, dass ich an so einem Strand entlangspaziere und zumindest anderen Leuten dabei zusehe, wie sie sich dem Am-Strand-Sitzen hingeben. Also ja: immer noch dieses Urlaubsbild haben.

Vielleicht ist es auch, weil ich ja in meiner expliziten Strandsitzaversion seit Jahren die Sonne als den nächsten großen Public Health Faktor vorauszusagen versuche. Also, vorauszusagen versuchen geht so, dass man s einfach so lange sagt, bis es eintritt, nicht wahr. Ich denk mir, bevor sie Alkoholfolgenfotos auf Flaschen kleben, werden sie eher den Solarkrebs ins öffentliche Bewusstsein rücken. Aber scheinbar gibt s bei den Zigaretten eh noch genug zu tun. (Bravo, so nebenher, dass sich Österreich zu einem Verbot durchgerungen hat…)
Anyway. Sonnenbrand in Südthailand: Ich hab ja relativ schnell einmal viel Freude dran gehabt, dass die Massagesalons Aloe-Vera Massagen anbieten.
Aber sonst, ich mein, es fangt ja wirklich erst an. In den letzten Tagen sind die Restaurants langsam voll geworden, abends sitzen jetzt ein paar Leute vor den Bars aus denen lauter Neunzigerpop dröhnt, auch der Strand füllt sich wie gesagt und selbst unser Tauchboot war schon wirklich so voll, dass es sich langsam für meinen Tauchshop echt auszahlen wird, ihr eigenes Boot zum Laufen zu kriegen. Weil das ist so, dass in der Nebensaison, da fahren jeden Tag nur zwei, drei Boote raus, war mein Eindruck. Da mieten sich quasi die verschiedenen Tauchschulen dann bei denen ein, die sagen, dass sie sowieso fahren und das ist dann auch in Ordnung für alle. So ein Tauchboot ist ja quasi die halbe Miete, da muss ja auch eine Crew bezahlt werden und ein Tank und die ganzen Tanks erst. Weil dass ich hier die schicksten Tauchboote befahre, die ich in meiner kurzen Karriere bisher befahren habe, hab ich das schon gesagt? So, wo wir zwanzig Gäste sind oder was und nochmal zehn InstruktorInnen oder FührerInnen. Und dann die Boys, weil auch hier hat s Boys, irgendwer muss ja die schlecht bezahlte Arbeit machen… Und einen Kapitän und dann sind wir eh vierzig Leute auf so einem Boot. Und wir sind auch ein, zwei Stunden bis zu unseren Tauchstätten unterwegs. Und dann gibt s Snackereien und ein ordentliches Mittagessen, weil wer taucht brennt Kalorien oder zumindest wird man müde davon, weil man zu viel Stickstoff im Blut hat und ich nehm an, es transportiert dann weniger Sauerstoff? Das müsste man wohl nachschauen.
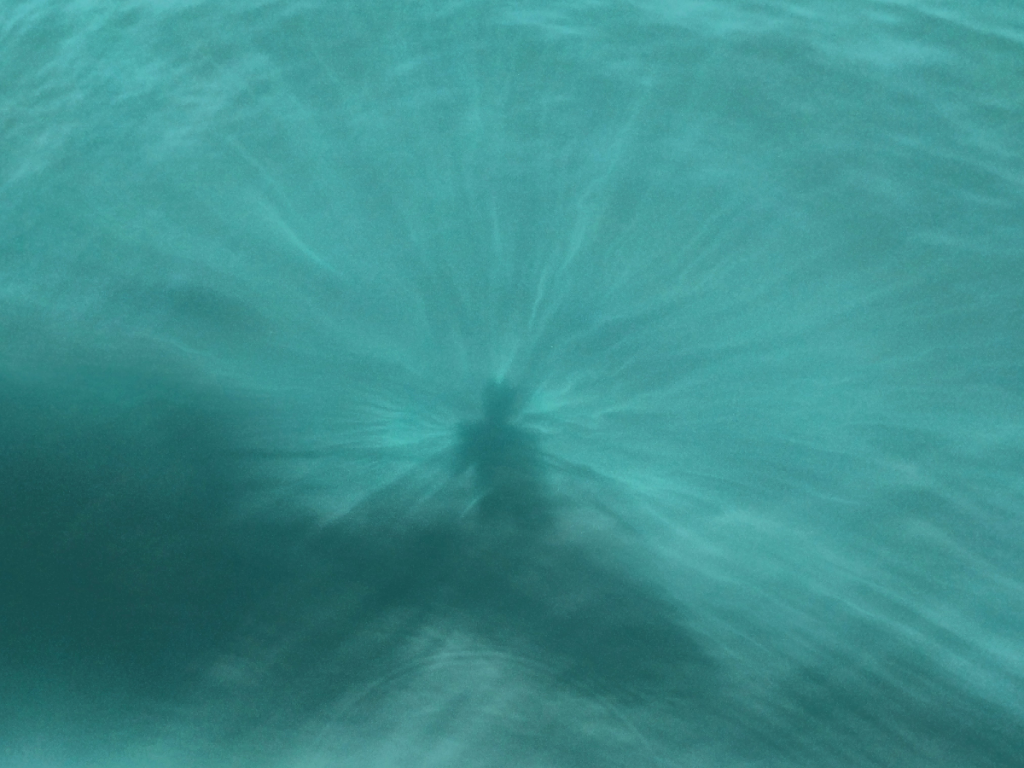
Na und das war jetzt auch voll, zuletzt. Und ja, da mischen sich dann die ÖsterreicherInnen (im Restaurant unverkennbar dank der Phrase can we pay?) und die SpanierInnen und die Deutschen und die SchweizerInnen und zwischendurch einmal drei Inder oder eine Chinesin. Aber eher noch das ganze Boot voll mit SchwedInnen. Das ist ja auch ein bisschen eine Überraschung, wenn die plötzlich in der Gruppe auftauchen. (Witzig übrigens, dass ich am Flughafen total viele ItalienerInnen zu hören bekomme, was am Boot nie vorgekommen ist.) Manchmal catern gewisse Destinationen schon sehr eine bestimmte Nationalität, dass am Hafen groß ein Swedish Restaurant angeschrieben und Schilder groß zum Snus Geschäft verweisen, das kommt unerwartet. Aber ich nehm an, das sind halt, so wie meine PolInnen, Leute, die sich sagen, na, machen wir halt ein schwedisches Restaurant auf einer thailändischen Insel auf, weil ich hab keine Lust mehr auf kalte Füße.
Aber wenn s Boot so voll ist, ist es mir eh fast gleich, wer da ist, bin ich schnell ein bisschen am Rückzug. Ich drück mich gerne ein bisschen bei den InstruktorInnen herum, einerseits, weil das überall die coolen Mädels und Burschen sind, aber auch, weil ich s interessant find, wie die das so machen und wie ihre Biografien so ausschauen. Ich mein, manchmal bin ich auch sehr umständlich, wenn ich einmal von einer ein bisserl sehr hingerissen bin, kommt ja auch vor. Da bin ich schnell wieder sehr verloren. Und dann gibt s die, die s mit der Lässigkeit vielleicht einmal ansatzweise übertreiben, je nach Tätowierungen, Gehabe und sonstigem Körperschmuck, denen geh ich ja dann auch einmal absichtlich ein bisschen aus dem Weg. Zu meiner Überraschung hebt ein kurzes Gespräch über der Frage in welchem Kübel der Anzug zu waschen wäre oder wo jetzt wieder das Spülmittel für die Masken sei, das erste Douche-Urteil dann doch oft als falsch auf. I guess das ist ein bisschen Teil von dieser Erfahrung, wo ich nach dem zweiten Tag einen anderen Eindruck hab als nach dem ersten und wo der dritte dann noch eine Überraschung bietet, die am vierten relativiert wird…
Das einzige, was mit einiger Sicherheit passiert, ist, dass sich die Haie nicht gezeigt haben. Oder die Mantas. Oder die Walhaie. Also alles was so unter die Kategorie der pelagial creatures fällt, quasi die echten MeeresbewohnerInnen, nicht nur die Rifffischchen. Aber da gibt s natürlich die Plätze, wo man sagt, da kommen sie vorbei, hier lassen sich die fünf Mantas putzen, hier hängen die Schwarzspitzenriffhaie üblicherweise vorbei und dort ist heute von wegen Planktonströmung vielleicht ein guter Tag, dass ein Walhai vorbeischaut. Und da starr ich dann einmal eine halbe Stunde lang into the blue, wie man sagt, und kann meine Aufregung über die Möglichkeit buchstäblich am Finimeter ablesen, weil Spannung braucht Luft. Aber halt Mal für Mal nix gewesen. Und da kann man sich da natürlich nicht beschweren. Aber wenn mich eine Instruktorin fragt, wie mein Tauchgang war dann zöger ich vielleicht doch so ein bisschen, weil ich quasi „nur das übliche“ zu sehen bekommen habe, obwohl ich ein bisschen auf pelagisches gespitzt hab. Sagt sie I believe you have expectations. Und sie meint das, glaub ich, als etwas negatives. Und das ist aus dem Buch: Leute, die die gleichen Wörter verwenden, aber etwas anderes damit meinen. Hab ich mich gefragt, ob das vielleicht was buddhistisches ist, weil da ist ja das ganze mit den Ansprüchen und den Erwartungen, die dann allesamt ständig enttäuscht werden und nie passiert da, was man gerne hätte… das spielt ja eine andere Rolle dort. Aber wie gesagt, eigentlich sind in der Gegend die Leute ja muslimisch und ich weiß nicht, wie der Islam mit dem Terror enttäuschter Erwartungshaltungen umgeht.

Und ja, das war eine thailändische Instruktorin. Das ist ja überhaupt so ein Ding, dass relativ wenige Einheimische in den (presumably) besser bezahlten Jobs arbeiten. Ist natürlich ernüchternd, dass von dem Tauchtourismus dann wieder die europäischen AussteigerInnen profitieren. Und natürlich haben auch die Restaurants und die Hotels und die Tourguides was davon, wenn jemand auf seinen Tauchurlaub vorbeikommt. Aber mein Geld ist zumindest vor allem an meine PolInnen gegangen. So wirklich ist mir das auch erst aufgefallen, wie mir die PolInnen den Wale als Guide mitgeschickt haben, der auf Ko Lanta aufgewachsen ist und der da für ihn selbst überraschend nämlich, plötzlich ein Tauchguide geworden ist. Aber natürlich bin ich dann, als ich ersteinmal draufgeschaut hab, eh schon wieder draufgekommen, dass es viel mehr thailändische InstruktorInnen gibt, als ich zuerst gedacht hab. Nur dass ich die halt nicht bemerkt hab, weil die weniger mit den Touris am Sonnendeck abhängen und eher vielleicht mit den Boys. Sagen wir ein Drittel.
Und zwischendurch wieder ein Franzose, mit dem ich mich gleich wieder gern unterhalten hab. Den haben sie uns als Fotografen mit an Bord gegeben und… ja. Schwer zu sagen. Ich hab ja dann mal gedacht, ob das mit den FranzösInnen vielleicht auch mehr so ist, wie mit den AmerikanerInnen, dass die, die man im Ausland trifft, eh nett und rücksichtsvoll und witzig sind. Oder auch nur, dass mir bei den einen wie den anderen die sympathischen eher auffallen als die anstrengenden. Auf jeden Fall ist er selbst in den kleinen Unterhaltungen, die wir so zwischendurch haben so angenehm französisch.

Mah, und meine Zehe hat sich wieder erholt, nachdem ich sie mit Karacho gegen den Gehsteigabgrenzungsboller gestoßen hab, manchmal drückt s immer noch unangenehm, wenn ich sie blöd erwische. Da frag ich mich dann, was man sich alles verletzen kann, wie unbemerkt man sich die Zehe brechen kann. Mehr Problem macht allerdings die Haut, weil da muss man sagen, das Tauchen, die Sonne und das Meer, das verlangt schon seinen Zoll. Die Haare hab ich sogar halbwegs im Griff, das schicke Boot erlaubt ja, dass ich mir nach jedem Tauchgang schnell einmal ein bisschen das Salz rausspühl. Aber ständig trockene Hände, meine Nagelbetten sind ausgefranst wie Rotwild im Frühling! Es ist wirklich nicht einfach. Da hab ich mir am letzten Tag noch eine Ölmassage gekauft, da hab ich mir gedacht, das hilft vielleicht. Auf jeden Fall bin ich unter den Schraubstockhänden der Masseurin beinahe gestorben, während sie und die Kollegin herzhaft über mein Ächzen und Stöhnen gelacht haben.
Und dann noch zwei, drei Sachen, die ich schon ein bisschen mit mir herumtrage, so aus: verschleppte Irrtümer. Wasser scheint man im Buddhismus quer durch die Bank als Opfer zu geben, was ich als bisschen brutale Opfergabe für die Atombombenopfer empfunden habe, ist gar nicht spezifisch in Erinnerung an deren qualvolles Verdursten. Ich mein, der Springbrunnen immer noch, aber vielleicht nicht unbedingt die Wasser.
Ah ja. Das andere war mehr so was, wo ich sag: oh schau, die progressive, emanzipatorische Kraft des Nationalismus, quelle surprise! Dass ich aber um die halbe Welt fahren sollte, für so ein Bild. Jetzt kann man natürlich sagen, die österreichische Herrschaft über die östlichen Nachbarn, das war vielleicht schon was anderes als die japanische Besetzung Koreas, natürlich sind die Rahmenbedingungen da ganz was anderes. Aber aus einer – sagmaramal –tschechischen Perspektive wird man da vielleicht auch leichter eine emanzipatorische Kraft dahinter erkennen. Wie gesagt, was sicher anders ist und weshalb ich mich dem koreanischen Nationalismus näher empfinde, ist, dass er halt nach wie vor ein progressives Ziel verfolgt in der Vereinigung der zwei Hälften Koreas. Und das ist ja etwas, was auf beiden Seiten ein Ziel ist, das – so scheint s mir – die entlang der Kalter-Krieg-Dichotomie gespaltene Politik der beiden Staaten transzendiert. Auf der anderen Seite gibt es in Mitteleuropa kaum ein Land, wo ich aus dem distanzierten (und österreichisch getrübten) Perspektive sagten würde, dass die ein besonders elegantes Verhältnis zum Nationalismus hätten. Serbien, Kroatien, Ungarn, Polen… Und ich mein zuhause ja auch nicht jetzt besonders. Das kann schon sein, dass das damit zu tun hat, dass sich die Fantasie vom eigenen Nationalstaat kaum jemals hat so wirklich umsetzen lassen. Ein Gefühl der Fremdbestimmung vom nächsten abgelöst. Aber ich nehme an, da sind wir auch wieder ein bisschen bei den unterschiedlichen Voraussetzungen.
Währenddessen zieht ein ziemliches Gewitter über den Flughafen von Krabi. Da sind ein paar recht beeindruckende Blitze nah genug eingeschlagen, dass wir den Donner quasi zeitgleich bekommen haben. Umso eindrucksvoller, als die Hauptbeleuchtung ausgefallen ist. Hinter mir sitzt ein spanisches Pärchen, die vorher laut irgendwelche spanischen Talkshows geschaut haben, aber als sie dann beim fünften, sechsten Blitz zum jammern begonnen hat („Ay!“), da hat er dann angefangen psch-psch zu machen. Hab ich mir auch gedacht, das ist schon ein männliches Verhalten.
Und dann war ich in Bangkok. Ja nur auf einen Sprung, nur auf eine Nacht, weil eigentlich bin ich in meiner zweiundfünfzigstündigen Reisebewegung von Ko Lanta nach Eriwan. Aber da ist die erste Übernachtung eben in Bangkok gewesen. Und da komm ich mit meinem letzten Geld, mit meinem vorletzten Geld, vom Flughafen zu meinem Hotel gefahren und dann ist da eine Hallowe’en Veranstaltung. Aber schau mich an, nachdem ich mich ein bisschen hergerichtet hab und kurz am Bett ausgestreckt hab, geh ich tatsächlich runter und unterhalte mich ein bisschen aus dem Hintergrund und dann doch noch mitten am Tisch mit den anderen Gästen.
Da sind dann wieder einmal zwei weiße Südafrikaner und das ist einfach nicht so einfach. Weil die Ding, die damals in Neuseeland begeistert auf Afrikaans geflucht hat, die war gut enthusiastisch über Streetfood und politische Graswurzelbewegungen und so, da konnte ich gut mit. Aber mit den Männern zu reden, die sagen, dass, ja, die Situation ist halt nicht besonders gut in Südafrika, weil sie zur Zeit für alle Stellen nachgereiht werden, weil Schwarze halt bevorzugt eingestellt werden. Ich seh schon ein, dass da eine Generation von SüdafrikanerInnen aufwächst, denen „ihr“ Südafrika in so einem Turnaround zerbröselt und die da eine Suppe serviert bekommen, die ihnen das Leben schwer macht. Oder wie auch immer man das betrachten möchte. Vielleicht ist das aber was, wo wir allesamt mehr hinschauen müssten, weil da offenbar eine weiße Mittelschicht ganz klar ihre Privilegien abgeben muss. Aber so hab ich schnell das Gefühl, ein bisschen in der Brisanz zu tappen, nachdem ich doch nur gefragt habe, warum sie seit drei Wochen im Hostel neben dem Flughafen wohnen. Und sie haben ja auch nicht einmal den Eindruck von Rassisten gemacht, aber das hat vielleicht in einem südafrikanischen Kontext alles ein bisschen eine andere Bedeutung. Ich mein, über die Formulierung opposite colour war ich schon etwas überrascht. Und wenngleich ich da also schnell einmal aufs Nachhaken verzichtet hab, erschien mir das schon sehr als ein Zeichen dafür, dass es da doch noch sehr dichotom zuginge, in der alltäglichen Politik Südafrikas.
Nächster Tag mit der S7 zum Flughafen in Novosibirsk. Das war ganz gemütlich, der längste Flug wahrscheinlich, auf dem ich kein Unterhaltungsprogramm hatte. Nicht einmal so einen Monitor, auf dem man sieht, wo man gerade drüberfliegt. Ich hab dann viel aus dem Fenster geschaut und das war schon aufregend, weil ich kurz nach Start draufgekommen bin, dass wir ja irgendwie über die Himalayas fliegen müssten. Und weil ich nicht genau weiß, wo Novosibirsk liegt hab ich zuerst gedacht, dass ich mich wohl leider auf die falsche Flugzeugseite eingecheckt hätte. Aber dann hatte ich doch ein paar Berge bei mir und dann hatte ich noch mehr Berge und vielleicht war irgendwas davon ja tatsächlich… also irgendwas davon war sicherlich der Himalaya. Und dann sind wir über Wüsten geflogen und das war auch beeindruckend, weil da einfach nur Steppe rumgelegen ist. Bevor ich mich dann wieder meinem Steven King gewidmet hab.

In Novosibirsk stand gleich neben der Tür dann ein bepelzmützter Sicherheitsbeamter, das hat mir schon einmal gut gefallen. Aber was noch etwas schräger war, dass in dem Schlauch, der vom Flugzeug in den -hafen geführt hat, für ein Reisebüro geworben wurde, die sich anextour nennen. Grad für ein russisches Reisebüro ist das irgendwie auch nicht unbrisant. Dann haben sie mich durch eine Passkontrolle geschickt, warum auch immer, da war eine Beamte mit Sternen an den Schultern, die meinen Pass genommen hat und mich dann auf Russisch was gefragt hat, was ich ihr nicht wirklich beantworten konnte. Dann hat sie ein bisschen telefoniert, mich eigentlich nicht mehr angeschaut und ich hab mir nur gedacht, wie sowjet-kafka ich hier verwaltet werde. Wie authentisch! Sie hat dann einen Rückruf bekommen und schnell meinen Pass durchgeblättert und mich nach Russland hineingestempelt. Was ich nicht ganz verstehe, weil ich mich ja eh nur im Transitbereich aufhalten darf ohne Visum. Aber natürlich freu ich mich auch ein bisschen darüber, da einen Stempel hineinbekommen zu haben. Novosibirsk drängt sich doch auf in meine Reiseberichte aufgenommen zu werden und wenn ich nur irgendwo am Flughafen rumlungern werde, beschallt mit Nena (99 Luftballons), Ace of Base (Wheel of Fortune), Cindy Lauper (Girls Just Wanna Have Fun) et al., fein synkopiert mit etwas leiserem Russischpop aus dem Café daneben. Bis sie mich morgen nach Eriwan schupfen.

