Dort, wo die Hüften die Hosen tragen,
Wäre es – um nicht zu sagen:
Ist ein Sonnenbrand unangenehm.
Nach sieben Wochen jetzt trotzdem geschehen.Ich trage seit längstem längere Shorts, stets die gleichen
Während die Badehosen nicht ganz so weit reichen.
Nun lagen wir lesend am Strand – eh beschattet
Sowie sorgfältig mit Crème Solaire ausgestattet.
Und doch ungewohnt der Sonne entblößt,
Hatt ich bald meine madige Farbe verbüßt.Ein Sonnenbrand allein tät mir
Den Tag noch nicht verderben.
Doch als der Römer auf ein Bier
hinzustoß, wollt ich sterben.Weil er Umweltschutz für die UN diskutiert.
Weil er auf Einladung hier ist und sich nicht geniert,
Fröhlich französische Lieder zu singen
Und lachend überall ein Gespräch zu beginnen.
Weil er den halben Pazifik durchtaucht
(wobei er nur die Luft seiner Lunge gebraucht).
Weil er “all of the Roman languages” spricht
Portugiesisch am liebsten; Rumänisch wohl nicht.
Weil er nachts am Himmel die Sternbilder zeigt
Auch wenn Cassiopeia sich in ein M verneigt.
Weil sein Hemd an den Schultern grad etwas spannt,
Die funkelnden Augen, die kräftige Hand…
Weil er gern nach dem Essen Zigarren raucht.
Den, en somme, hätte ich echt nicht gebraucht.
Schlagwort: Tauchen
Rückblicke
Es ist nicht so einfach mit dem Schreiben. Ich mein, es ist nicht so einfach mit dem Leben in the first place. Und die beiden hängen ja zusammen.
Ich hab mir schon vorgestellt, ich schreib dann einfach wieder. Am Abend hinsetzen und die Gedanken des Tages irgendwie unterbringen in den Worten und ein Bild dazu und irgendwie dann die Freude, was getan zu haben und irgendwie auch in Kontakt getreten zu sein. Die Bedürfnisse sind überschaubar. Aber es ging dann einfach nicht, zumindest einfach nicht so einfach.

Segeln war gut. Und dabei so fordernd. Da hab ich mich am Abend nicht hingesetzt, da hab ich mich hingelegt am Abend, weil am nächsten Tag ging s weiter. Wenn man in zwei Wochen um die kanarischen Inseln segeln möchte, muss man sich offenbar dranhalten. Am Anfang sind wir gleich mal zweimal durch die Nacht gesegelt. Das war nur mittel ein Spaß, die Andrea hat rückblickend einmal vorsichtig formuliert: „There were moments, when I didn’t enjoy the banter.“ Das hat s ganz gut getroffen. Es war dann einfach zu viel für den Anfang: Drei Stunden Segeln, drei Stunden Schlafen… von sieben bis sieben.
Wenigstens waren wir dann einmal auf Fuerteventura und dann auf Gran Canaria. Das war der Deal: wir hatten ein Rettungsboot zum Service zu bringen. Und dann hätten wir ruhiger unterwegs sein können. Das hat auch funktioniert für ein paar Tage, da sind wir gemütlich nach Tenerifa, nach La Gomera und schließlich nach La Palma gesegelt, schöne Tagespassagen, alles fein. Der Vorteil in der Nacht, hat sich dann herausgestellt, ist das mit der Sonne. Aber das war im Grunde auch ok, ich lerne großzügig mit der Sonnencreme zu sein. Ich halte mich mittlerweile an das Credo „Wer aus dem Urlaub Sonnencreme mit heimbringt, hat zu wenig verwendet.“

Aber dann hat sich herausgestellt, der Wind kommt jetzt von Osten. Das gibt s normalerweise überhaupt nicht, da ist immer ein Nordwind und das ist wunderbar gemütlich, da auf einem beam reach heimzufahren. Die deutschen Bezeichnungen in dem ganzen Segelbusiness sind übrigens dermaßen archaisch oder zumindest sind das auch alles Vokabeln, die man auf die eine oder andere Art auswendig lernen müsste, da kann man wirklich gleich die englischen Begriffe lernen. Aber für wer will:
A beam reach is when the true wind is at a right angle to the direction of motion.
en.wikipedia.org
Halber Wind bezeichnet einen Kurs, bei dem der Verklicker ungefähr rechtwinklig ausweht, der scheinbare Wind also mit ungefähr 90° einfällt. Die Segel werden im Vergleich zum Am-Wind-Kurs etwas geöffnet („die Schoten gefiert“). Während auf einem Halbwindkurs nach wie vor der größte Teil des Vortriebs durch Strömung am Segel hervorgerufen wird, ist ein weiterer Teil auch auf Winddruck auf das Segel zurückzuführen.
de.wikipedia.org
Also ja. Interessant ist bei den beiden aber, dass die englische Bezeichnung vom true wind ausgeht, also der Wind, der auf ein ruhendes Segelboot einwirkt. Während auf Deutsch sinnvollerweise der scheinbare Wind herangezogen wird, der sich aus dem true wind plus dem Fahrtwind ergibt. Und das ist der Wind, wie er sich letztlich auf das Boot auswirkt.
Ja, es ist jetzt nicht so, als ob ich nichts lernen würde, in meinen Kursen.

Na auf jeden Fall haben wir uns dann erst wieder beeilen müssen, La Palma hinter uns gelassen und in einem Mordsaufwand 48 Stunden lang die ganze Strecke wieder zurückgesegelt. Und da, muss ich sagen, hab ich stellenweise einiges nicht mehr so wirklich genossen. Zum Beispiel, wie ich mein Fensterchen nicht ganz zugemacht hab. Das ist ja so ein Ding, irgendwie, diese Luken. Die macht man ja dicht. Und dafür gibt s eben so kleine Schnapperl. Jetzt wenn die nicht offen sind, wenn man die Luke zumacht, und sagen wir, die anderen Schnapperl zumacht. Das schaut super aus, schaut aus als wär s zu. Und da ist wirklich nur ein kleiner Spalt, klitzekleiner Spalt. Aber da kommt mitunter dann so eine Welle und da passt sehr viel Wasser durch so einen kleinen Spalt, hab ich dann gemerkt, während ich eigentlich meine Schlafstunden hatte.
Ah, das fühlt sich nicht gut an. Im ersten Moment hab ich gedacht, die anderen sind schuld. Eh klar, erster Reflex. Aber während ich dann da unter Deck im Dunkeln bisschen hin- und hergeflogen bin, auf der Suche nach was, um meine Kabine trocken zu legen, hab ich die Situation wohl halbwegs rekonstruiert. Und wie ich dann ins Cockpit raufgeschaut hab, wo Andrea und Richard ihre Segelschicht verbracht haben, da war s gar nicht mehr so anklangend gemeint, wie ich gesagt hab, dass mir gerade das Wasser durch die Luke gespritzt ist. Aber natürlich: Die zwei sind da seit Stunden gesessen und haben das Wasser zwar nicht ins Bett, aber doch ständig ins Gesicht und viel zu tief, wie sich später herausgestellt hat, in die „wasserdichten“ Jacken bekommen. Insofern durchaus zurecht, dass man mir da bisschen schnippisch drauf reagiert hat. Ich hab mich wieder hingelegt, halt um das Wasser in meiner Matratze herum. Man kriegt seinen Schlaf nicht nachgereicht.
Und ja. So wie wir dann da gesegelt sind, ist der Wind so knapp wie möglich von vorne gekommen, das heißt, dass auch die Wellen in erster Linie von vorne gekommen sind und es hat dauernd swisch-swasch-swusch gemacht. Mit jeder Welle hat s das Boot hochgehoben und wieder fallen lassen. Und im schlimmeren Fall ist die nächste Welle, beim Fallengelassenwerden dann schon da und schwappt einem drüber. Man spürt richtig, wie in dem Wort noch das Gefühl drinsteckt: Schwapp.

Und dann ist es ein fröhliches Ankommen. Das Interessante beim Ankommen ist ja auch, wie lang das dauert. Weil zwischen Land-in-Sicht und das Boot festbinden ist ein halber Tag. Bei guter Sicht. Und natürlich wollten wir nicht gleich an das erste Land, das sich uns da so gezeigt hat, weil die Westküste von Fuerteventura ist offenbar eher eine Steppe. Wir wollten nach Rubicon. Rubicon ist an der Südspitze von Lanzarote und dort sind wir eingefallen, als wären wir monatelang auf See gewesen. Aber man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man nach zwei Tagen ankommt und die ganzen kleinen Ärgerlichkeiten, die man am Boot schluckt, weil sie eh nur aus dem eigenen Unwohlsein stammen, die Begrenztheit, in der man nur zwischen Bett und Deck die Wahl hat, keine drei Schritte gehen kann. Ein Bad, ein Klo, eine Dusche… Aber auch: viel Bier. Zu viel Bier vielleicht. Und am zweiten Tag war die Freude dann zwar weck, aber das Upper Deck hat wieder gerufen und dann war the Scottish Bird auch wieder da. Ich hab leider ihren Namen vergessen, aber die Selbstverständlichkeit, mit der Richard sie so genannt hat, steckt mir noch in den Knochen. Ihr Mann hat sie schon am Vortag auf die Tanzfläche geholt und selbst wenn der Sänger am ersten Tag besser war, als der am zweiten, sie haben wieder die ganze Bar motiviert, zumindest für ein, zwei Nummern bisschen mit den Extremitäten zu schlenkern. Sure, mich auch. „I heard [gute Gelegenheit an dieser Stelle, einen Glaswegian Akzent einzubauen] you two were German?“ ist sie zu Andrea und mir rübergekommen. „Well,“ sag ich, „that’s not technically correct…“, aber dann denk ich mir, man kann kaum was deutscheres sagen, also lass ich s stehen.

Ich hab seither nur sehr wenig Alkohol getrunken. Wir haben dann am nächsten Tag noch ein paar Manöver gemacht, bojenförmige Personen über Bord fallen lassen, marokkanischen Minen ausgewichen, zwischen ankernden Segelbooten gekreuzt… very excited. Weil wir waren jetzt zu früh wieder daheim. Die Windprognose hat sich angeboten, die Rückfahrt anzutreiben, weil besser wäre es nicht geworden. Und das ist auf eine eigene Art erstaunlich, weil bis dahin, hat sich Peter (der Instructor, jetzt haben wir endlich alle beisammen) nie besonders am Windwetterbericht („Predict Wind? More like Guess Wind.“) orientiert. Aber scheinbar, wenn ein starker Ostwind angesagt ist, wo wir nach Osten wollen, da glaubt man s dann doch lieber.
So waren die letzten Tage aber zumindest gemütlich: In der Nach im sicheren Hafen, abends, schön essen gehen in der Marina von Puerto Calero. Und dann sogar noch ein Rugby Spiel. Weil das kann man schon auch sehen: zum letzten Rugby World Cup, war ich in Japan. Also, nicht literally zum World Cup, aber es war der World Cup in Japan und ich war in Japan. Und jetzt war ich zumindest mit einem Engländer und einem Neuseeländer unterwegs, die beide sehr interessiert waren, wie s denn da weitergeht, bei den Rugbys. Ja, und jetzt bin ich in Paris, aber psssht! Spoilers.
Dann haben wir also Rugby geschaut. Und ich muss sagen, es war schon ok. Es dauert nur 80 Minuten und irgendwie ist die Action etwas fokussierter bzw. man konnte dem allen ganz gut folgen, hat schnell gesehen, dass die eine Mannschaft halt nicht gut spielt und die andere schon. Ich glaub, das war Frankreich gegen Italien. Es hat dann irgendwie zu lange gedauert und wir hatten noch ein Bier (ja, ja, aber danach wirklich nur noch ein Bier seitdem) und dann gab s noch ein unschönes Ende, weil der Peter nicht ganz gut der Andrea zuhören wollte – nachdem er sie gefragt hat – wobei sie den Eindruck hatte, er sei mit ihr ob Gender wegen, doch anders umgegangen. Es war nicht mehr zu retten. Ich möchte sagen, ich hab s versucht, aber irgendwie bin ich mir nachher trotzdem schlecht vorgekommen, weil ich sitzengeblieben bin, als sie auf ist, mit Tränen.

Das war so ein bisschen ein Moment, in dem ich gemerkt hab, dass ich schon gern daheim bin. Und wenn das auch nur bedeutet, mehrheitlich mit Menschen umgeben zu sein, mit denen man ein gemeinsames Wertesystem teilt. Und wo man sich nicht nachher eine Woche lang daran abarbeitet, wie die Welt einfach nicht gut ist und wo man den Strich zieht und wo man aber um der eigenen Gemütlichkeit vielleicht darauf verzichtet, ein Zeichen zu setzen und zu sagen: Du hast gefragt, du kannst ihr jetzt nicht absprechen, dass sie das gefühlt hat. Nur zum Beispiel.
Und so hat das alles irgendwie unverdient ein rasches, etwas ungutes Ende genommen, schlechter Nachgeschmack inklusive. So bin ich mit diesen Gedanken noch eine Woche in Puerto del Carmen gesessen, wieder in einem etwas zu großzügigen Apartment, aber günstiger, weil 20 Minuten zum Strand und 10 Minuten zum Supermarkt. Hab mir Papayas gegessen, Brettspiele am Handy gespielt und war Tauchen mit den spanischen Tourist*innen. Aber so dieses Gefühl, wie gut das mit dem Segeln gelaufen ist, das hab ich mir diesmal nicht mitgenommen. Im Gegenteil. Das Rucken und Zucken in der Nacht, das mühsame Aufstehen um fünf in der Früh, selbst wenn s die Sonnenaufgangsschicht ist. Und halt auch das Gefühl, dass ich vielleicht immer noch eine vergleichsweise lustige Gruppe erwischt hab, mit der ich diese zwei Wochen gemeinsam geteilt habe. Aber selbst eine lustige Gruppe ist nicht dasselbe wie, sagen wir: Wohlfühlen.

Zusammengenommen hat die Idee, jetzt zwei, drei Wochen nach Amerika zu segeln einfach an Sexyness verloren gehabt. Ich segel schon gern. Aber vielleicht lieber mal mit Leuten, die ich gern hab und für die Freude. Weil es war schön. Ich find s super, zu lernen, wie sich das Boot verhält, sich lenken lässt und wo ich ein bisschen über meinen Schatten steigen muss, weil das Boot gehört so schief, sonst läuft s nicht gut. Und dann in einer Bucht zu ankern und ins Wasser zu springen – nachdem man sich versichert hat, dass der Anker hält. Vielleicht schwimmt der Richard – „last one at the beach is a rotten apple!“ – zum Strand und nach längerem Überlegen denk ich mir dann, ja, sure, why not. Und es ist ein super Gefühl, einen Strand vom Meer her zu betreten, bisschen im Sand sitzend zu Atem kommen und dann wieder zurück. Und „Wale“ zu sehen, zwei, drei Meter am Boot vorbei und Delphine, die uns begleiten und Schildkröten, die an der Wasseroberfläche herumgeworfen werden. Das sind schöne, aufregende Erfahrungen. Es ist nur schade, dass die Leute auf eine wohl ganz alltäglich Art manchmal bisserl ungut sind.
Zf1G (14) – Santa Maria, PT
to the Americans who made me read these aloud and kindly snipped their fingers in response
Taking a break between dives
Waiting for the body to release the nitrogen
Regaining some warmth left in the deep blue.The boat rocking slowly on top
Waiting for the body to release my breakfast
With my pale face turned into a deep white.Just a seagull’s fleeting shadow
Waiting for the body to release its inflammatory response
Another layer of skin lost to the deep red.
Off with the fairies
Wieder ein Flughafen, wieder ein Aufbruch. Diesmal bin ich aber wirklich etwas länger unterwegs und vielleicht ist das auch symbolisch irgendwie. Oder so herum: vielleicht will man da auch irgendwas symbolisches drin erkennen. Immerhin verlasse ich die Tropen, hab ich festgestellt, als ich mir heute Morgen beim Das-letzte-Mal-den-Strand-entlang-Gehen beinahe einen halbseitigen Sonnenbrand geholt hätte. Da setzen sich die Leute echt noch in die Sonne mit ihrer Joghurthaut! Das hat mich wirklich ein bisschen überrascht, dass Leute immer noch dieses Urlaubsbild haben, dass sie sich am ersten Tag mit einem Buch in den Sand setzen müssen. Und die, die sich nicht ganz der Illusion hingeben, dass das an sich eine gute Idee wäre, die schmieren sich eh zentimeterdick mit Sonnencreme ein, dass man die Molke kaum durchschimmern sieht. Man mag darin auch eine Arroganz sehen, weil ich doch seit Monaten unter Palmen schlender und deren ja längst indifferent geworden mögen… habe… sein. Aber ich hebe den Arm und strecke den Finger gen Himmel um das Augenmerk darauf zu lenken, dass ich das vor einem Jahr so ähnlich gesehen hätte. Und in der Tat hab ich kaum jemals Zeit am Strand verbracht und ich würde sogar sagen: das ist das erste Mal seit Australien, wo ich das mal probiert habe und dann wieder raus bin, weil ich das Meer ganz allein plötzlich als unheimlich empfunden habe, das erste Mal, dass ich an so einem Strand entlangspaziere und zumindest anderen Leuten dabei zusehe, wie sie sich dem Am-Strand-Sitzen hingeben. Also ja: immer noch dieses Urlaubsbild haben.

Vielleicht ist es auch, weil ich ja in meiner expliziten Strandsitzaversion seit Jahren die Sonne als den nächsten großen Public Health Faktor vorauszusagen versuche. Also, vorauszusagen versuchen geht so, dass man s einfach so lange sagt, bis es eintritt, nicht wahr. Ich denk mir, bevor sie Alkoholfolgenfotos auf Flaschen kleben, werden sie eher den Solarkrebs ins öffentliche Bewusstsein rücken. Aber scheinbar gibt s bei den Zigaretten eh noch genug zu tun. (Bravo, so nebenher, dass sich Österreich zu einem Verbot durchgerungen hat…)
Anyway. Sonnenbrand in Südthailand: Ich hab ja relativ schnell einmal viel Freude dran gehabt, dass die Massagesalons Aloe-Vera Massagen anbieten.
Aber sonst, ich mein, es fangt ja wirklich erst an. In den letzten Tagen sind die Restaurants langsam voll geworden, abends sitzen jetzt ein paar Leute vor den Bars aus denen lauter Neunzigerpop dröhnt, auch der Strand füllt sich wie gesagt und selbst unser Tauchboot war schon wirklich so voll, dass es sich langsam für meinen Tauchshop echt auszahlen wird, ihr eigenes Boot zum Laufen zu kriegen. Weil das ist so, dass in der Nebensaison, da fahren jeden Tag nur zwei, drei Boote raus, war mein Eindruck. Da mieten sich quasi die verschiedenen Tauchschulen dann bei denen ein, die sagen, dass sie sowieso fahren und das ist dann auch in Ordnung für alle. So ein Tauchboot ist ja quasi die halbe Miete, da muss ja auch eine Crew bezahlt werden und ein Tank und die ganzen Tanks erst. Weil dass ich hier die schicksten Tauchboote befahre, die ich in meiner kurzen Karriere bisher befahren habe, hab ich das schon gesagt? So, wo wir zwanzig Gäste sind oder was und nochmal zehn InstruktorInnen oder FührerInnen. Und dann die Boys, weil auch hier hat s Boys, irgendwer muss ja die schlecht bezahlte Arbeit machen… Und einen Kapitän und dann sind wir eh vierzig Leute auf so einem Boot. Und wir sind auch ein, zwei Stunden bis zu unseren Tauchstätten unterwegs. Und dann gibt s Snackereien und ein ordentliches Mittagessen, weil wer taucht brennt Kalorien oder zumindest wird man müde davon, weil man zu viel Stickstoff im Blut hat und ich nehm an, es transportiert dann weniger Sauerstoff? Das müsste man wohl nachschauen.
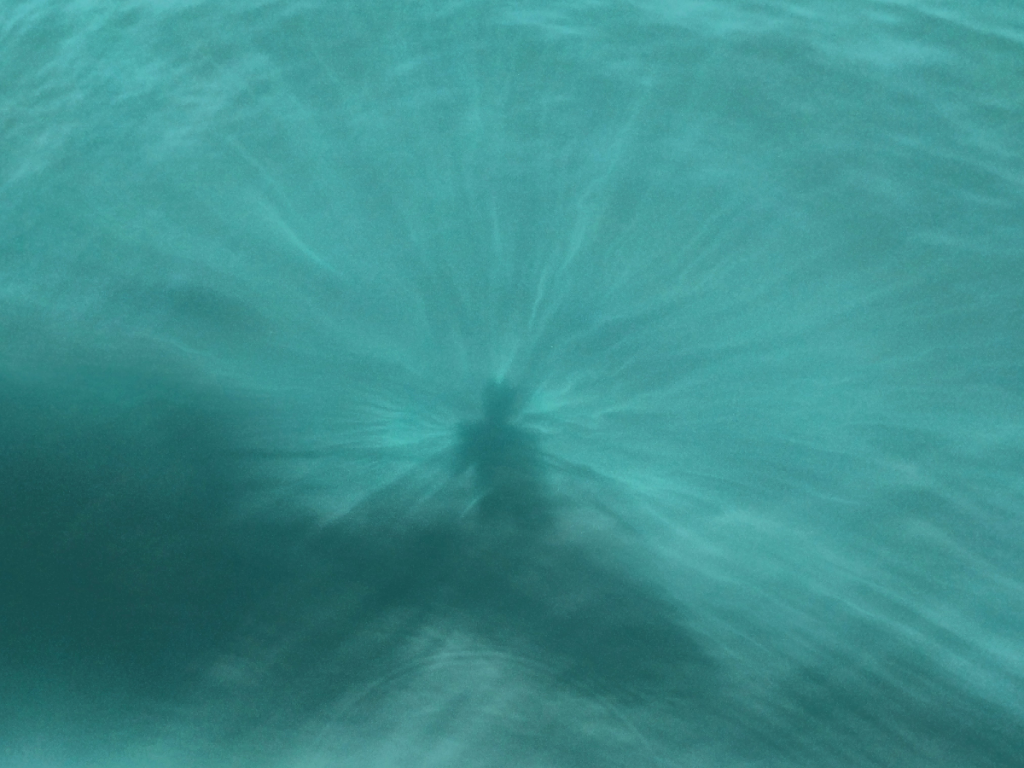
Na und das war jetzt auch voll, zuletzt. Und ja, da mischen sich dann die ÖsterreicherInnen (im Restaurant unverkennbar dank der Phrase can we pay?) und die SpanierInnen und die Deutschen und die SchweizerInnen und zwischendurch einmal drei Inder oder eine Chinesin. Aber eher noch das ganze Boot voll mit SchwedInnen. Das ist ja auch ein bisschen eine Überraschung, wenn die plötzlich in der Gruppe auftauchen. (Witzig übrigens, dass ich am Flughafen total viele ItalienerInnen zu hören bekomme, was am Boot nie vorgekommen ist.) Manchmal catern gewisse Destinationen schon sehr eine bestimmte Nationalität, dass am Hafen groß ein Swedish Restaurant angeschrieben und Schilder groß zum Snus Geschäft verweisen, das kommt unerwartet. Aber ich nehm an, das sind halt, so wie meine PolInnen, Leute, die sich sagen, na, machen wir halt ein schwedisches Restaurant auf einer thailändischen Insel auf, weil ich hab keine Lust mehr auf kalte Füße.
Aber wenn s Boot so voll ist, ist es mir eh fast gleich, wer da ist, bin ich schnell ein bisschen am Rückzug. Ich drück mich gerne ein bisschen bei den InstruktorInnen herum, einerseits, weil das überall die coolen Mädels und Burschen sind, aber auch, weil ich s interessant find, wie die das so machen und wie ihre Biografien so ausschauen. Ich mein, manchmal bin ich auch sehr umständlich, wenn ich einmal von einer ein bisserl sehr hingerissen bin, kommt ja auch vor. Da bin ich schnell wieder sehr verloren. Und dann gibt s die, die s mit der Lässigkeit vielleicht einmal ansatzweise übertreiben, je nach Tätowierungen, Gehabe und sonstigem Körperschmuck, denen geh ich ja dann auch einmal absichtlich ein bisschen aus dem Weg. Zu meiner Überraschung hebt ein kurzes Gespräch über der Frage in welchem Kübel der Anzug zu waschen wäre oder wo jetzt wieder das Spülmittel für die Masken sei, das erste Douche-Urteil dann doch oft als falsch auf. I guess das ist ein bisschen Teil von dieser Erfahrung, wo ich nach dem zweiten Tag einen anderen Eindruck hab als nach dem ersten und wo der dritte dann noch eine Überraschung bietet, die am vierten relativiert wird…
Das einzige, was mit einiger Sicherheit passiert, ist, dass sich die Haie nicht gezeigt haben. Oder die Mantas. Oder die Walhaie. Also alles was so unter die Kategorie der pelagial creatures fällt, quasi die echten MeeresbewohnerInnen, nicht nur die Rifffischchen. Aber da gibt s natürlich die Plätze, wo man sagt, da kommen sie vorbei, hier lassen sich die fünf Mantas putzen, hier hängen die Schwarzspitzenriffhaie üblicherweise vorbei und dort ist heute von wegen Planktonströmung vielleicht ein guter Tag, dass ein Walhai vorbeischaut. Und da starr ich dann einmal eine halbe Stunde lang into the blue, wie man sagt, und kann meine Aufregung über die Möglichkeit buchstäblich am Finimeter ablesen, weil Spannung braucht Luft. Aber halt Mal für Mal nix gewesen. Und da kann man sich da natürlich nicht beschweren. Aber wenn mich eine Instruktorin fragt, wie mein Tauchgang war dann zöger ich vielleicht doch so ein bisschen, weil ich quasi „nur das übliche“ zu sehen bekommen habe, obwohl ich ein bisschen auf pelagisches gespitzt hab. Sagt sie I believe you have expectations. Und sie meint das, glaub ich, als etwas negatives. Und das ist aus dem Buch: Leute, die die gleichen Wörter verwenden, aber etwas anderes damit meinen. Hab ich mich gefragt, ob das vielleicht was buddhistisches ist, weil da ist ja das ganze mit den Ansprüchen und den Erwartungen, die dann allesamt ständig enttäuscht werden und nie passiert da, was man gerne hätte… das spielt ja eine andere Rolle dort. Aber wie gesagt, eigentlich sind in der Gegend die Leute ja muslimisch und ich weiß nicht, wie der Islam mit dem Terror enttäuschter Erwartungshaltungen umgeht.

Und ja, das war eine thailändische Instruktorin. Das ist ja überhaupt so ein Ding, dass relativ wenige Einheimische in den (presumably) besser bezahlten Jobs arbeiten. Ist natürlich ernüchternd, dass von dem Tauchtourismus dann wieder die europäischen AussteigerInnen profitieren. Und natürlich haben auch die Restaurants und die Hotels und die Tourguides was davon, wenn jemand auf seinen Tauchurlaub vorbeikommt. Aber mein Geld ist zumindest vor allem an meine PolInnen gegangen. So wirklich ist mir das auch erst aufgefallen, wie mir die PolInnen den Wale als Guide mitgeschickt haben, der auf Ko Lanta aufgewachsen ist und der da für ihn selbst überraschend nämlich, plötzlich ein Tauchguide geworden ist. Aber natürlich bin ich dann, als ich ersteinmal draufgeschaut hab, eh schon wieder draufgekommen, dass es viel mehr thailändische InstruktorInnen gibt, als ich zuerst gedacht hab. Nur dass ich die halt nicht bemerkt hab, weil die weniger mit den Touris am Sonnendeck abhängen und eher vielleicht mit den Boys. Sagen wir ein Drittel.
Und zwischendurch wieder ein Franzose, mit dem ich mich gleich wieder gern unterhalten hab. Den haben sie uns als Fotografen mit an Bord gegeben und… ja. Schwer zu sagen. Ich hab ja dann mal gedacht, ob das mit den FranzösInnen vielleicht auch mehr so ist, wie mit den AmerikanerInnen, dass die, die man im Ausland trifft, eh nett und rücksichtsvoll und witzig sind. Oder auch nur, dass mir bei den einen wie den anderen die sympathischen eher auffallen als die anstrengenden. Auf jeden Fall ist er selbst in den kleinen Unterhaltungen, die wir so zwischendurch haben so angenehm französisch.

Mah, und meine Zehe hat sich wieder erholt, nachdem ich sie mit Karacho gegen den Gehsteigabgrenzungsboller gestoßen hab, manchmal drückt s immer noch unangenehm, wenn ich sie blöd erwische. Da frag ich mich dann, was man sich alles verletzen kann, wie unbemerkt man sich die Zehe brechen kann. Mehr Problem macht allerdings die Haut, weil da muss man sagen, das Tauchen, die Sonne und das Meer, das verlangt schon seinen Zoll. Die Haare hab ich sogar halbwegs im Griff, das schicke Boot erlaubt ja, dass ich mir nach jedem Tauchgang schnell einmal ein bisschen das Salz rausspühl. Aber ständig trockene Hände, meine Nagelbetten sind ausgefranst wie Rotwild im Frühling! Es ist wirklich nicht einfach. Da hab ich mir am letzten Tag noch eine Ölmassage gekauft, da hab ich mir gedacht, das hilft vielleicht. Auf jeden Fall bin ich unter den Schraubstockhänden der Masseurin beinahe gestorben, während sie und die Kollegin herzhaft über mein Ächzen und Stöhnen gelacht haben.
Und dann noch zwei, drei Sachen, die ich schon ein bisschen mit mir herumtrage, so aus: verschleppte Irrtümer. Wasser scheint man im Buddhismus quer durch die Bank als Opfer zu geben, was ich als bisschen brutale Opfergabe für die Atombombenopfer empfunden habe, ist gar nicht spezifisch in Erinnerung an deren qualvolles Verdursten. Ich mein, der Springbrunnen immer noch, aber vielleicht nicht unbedingt die Wasser.
Ah ja. Das andere war mehr so was, wo ich sag: oh schau, die progressive, emanzipatorische Kraft des Nationalismus, quelle surprise! Dass ich aber um die halbe Welt fahren sollte, für so ein Bild. Jetzt kann man natürlich sagen, die österreichische Herrschaft über die östlichen Nachbarn, das war vielleicht schon was anderes als die japanische Besetzung Koreas, natürlich sind die Rahmenbedingungen da ganz was anderes. Aber aus einer – sagmaramal –tschechischen Perspektive wird man da vielleicht auch leichter eine emanzipatorische Kraft dahinter erkennen. Wie gesagt, was sicher anders ist und weshalb ich mich dem koreanischen Nationalismus näher empfinde, ist, dass er halt nach wie vor ein progressives Ziel verfolgt in der Vereinigung der zwei Hälften Koreas. Und das ist ja etwas, was auf beiden Seiten ein Ziel ist, das – so scheint s mir – die entlang der Kalter-Krieg-Dichotomie gespaltene Politik der beiden Staaten transzendiert. Auf der anderen Seite gibt es in Mitteleuropa kaum ein Land, wo ich aus dem distanzierten (und österreichisch getrübten) Perspektive sagten würde, dass die ein besonders elegantes Verhältnis zum Nationalismus hätten. Serbien, Kroatien, Ungarn, Polen… Und ich mein zuhause ja auch nicht jetzt besonders. Das kann schon sein, dass das damit zu tun hat, dass sich die Fantasie vom eigenen Nationalstaat kaum jemals hat so wirklich umsetzen lassen. Ein Gefühl der Fremdbestimmung vom nächsten abgelöst. Aber ich nehme an, da sind wir auch wieder ein bisschen bei den unterschiedlichen Voraussetzungen.
Währenddessen zieht ein ziemliches Gewitter über den Flughafen von Krabi. Da sind ein paar recht beeindruckende Blitze nah genug eingeschlagen, dass wir den Donner quasi zeitgleich bekommen haben. Umso eindrucksvoller, als die Hauptbeleuchtung ausgefallen ist. Hinter mir sitzt ein spanisches Pärchen, die vorher laut irgendwelche spanischen Talkshows geschaut haben, aber als sie dann beim fünften, sechsten Blitz zum jammern begonnen hat („Ay!“), da hat er dann angefangen psch-psch zu machen. Hab ich mir auch gedacht, das ist schon ein männliches Verhalten.
Und dann war ich in Bangkok. Ja nur auf einen Sprung, nur auf eine Nacht, weil eigentlich bin ich in meiner zweiundfünfzigstündigen Reisebewegung von Ko Lanta nach Eriwan. Aber da ist die erste Übernachtung eben in Bangkok gewesen. Und da komm ich mit meinem letzten Geld, mit meinem vorletzten Geld, vom Flughafen zu meinem Hotel gefahren und dann ist da eine Hallowe’en Veranstaltung. Aber schau mich an, nachdem ich mich ein bisschen hergerichtet hab und kurz am Bett ausgestreckt hab, geh ich tatsächlich runter und unterhalte mich ein bisschen aus dem Hintergrund und dann doch noch mitten am Tisch mit den anderen Gästen.
Da sind dann wieder einmal zwei weiße Südafrikaner und das ist einfach nicht so einfach. Weil die Ding, die damals in Neuseeland begeistert auf Afrikaans geflucht hat, die war gut enthusiastisch über Streetfood und politische Graswurzelbewegungen und so, da konnte ich gut mit. Aber mit den Männern zu reden, die sagen, dass, ja, die Situation ist halt nicht besonders gut in Südafrika, weil sie zur Zeit für alle Stellen nachgereiht werden, weil Schwarze halt bevorzugt eingestellt werden. Ich seh schon ein, dass da eine Generation von SüdafrikanerInnen aufwächst, denen „ihr“ Südafrika in so einem Turnaround zerbröselt und die da eine Suppe serviert bekommen, die ihnen das Leben schwer macht. Oder wie auch immer man das betrachten möchte. Vielleicht ist das aber was, wo wir allesamt mehr hinschauen müssten, weil da offenbar eine weiße Mittelschicht ganz klar ihre Privilegien abgeben muss. Aber so hab ich schnell das Gefühl, ein bisschen in der Brisanz zu tappen, nachdem ich doch nur gefragt habe, warum sie seit drei Wochen im Hostel neben dem Flughafen wohnen. Und sie haben ja auch nicht einmal den Eindruck von Rassisten gemacht, aber das hat vielleicht in einem südafrikanischen Kontext alles ein bisschen eine andere Bedeutung. Ich mein, über die Formulierung opposite colour war ich schon etwas überrascht. Und wenngleich ich da also schnell einmal aufs Nachhaken verzichtet hab, erschien mir das schon sehr als ein Zeichen dafür, dass es da doch noch sehr dichotom zuginge, in der alltäglichen Politik Südafrikas.
Nächster Tag mit der S7 zum Flughafen in Novosibirsk. Das war ganz gemütlich, der längste Flug wahrscheinlich, auf dem ich kein Unterhaltungsprogramm hatte. Nicht einmal so einen Monitor, auf dem man sieht, wo man gerade drüberfliegt. Ich hab dann viel aus dem Fenster geschaut und das war schon aufregend, weil ich kurz nach Start draufgekommen bin, dass wir ja irgendwie über die Himalayas fliegen müssten. Und weil ich nicht genau weiß, wo Novosibirsk liegt hab ich zuerst gedacht, dass ich mich wohl leider auf die falsche Flugzeugseite eingecheckt hätte. Aber dann hatte ich doch ein paar Berge bei mir und dann hatte ich noch mehr Berge und vielleicht war irgendwas davon ja tatsächlich… also irgendwas davon war sicherlich der Himalaya. Und dann sind wir über Wüsten geflogen und das war auch beeindruckend, weil da einfach nur Steppe rumgelegen ist. Bevor ich mich dann wieder meinem Steven King gewidmet hab.

In Novosibirsk stand gleich neben der Tür dann ein bepelzmützter Sicherheitsbeamter, das hat mir schon einmal gut gefallen. Aber was noch etwas schräger war, dass in dem Schlauch, der vom Flugzeug in den -hafen geführt hat, für ein Reisebüro geworben wurde, die sich anextour nennen. Grad für ein russisches Reisebüro ist das irgendwie auch nicht unbrisant. Dann haben sie mich durch eine Passkontrolle geschickt, warum auch immer, da war eine Beamte mit Sternen an den Schultern, die meinen Pass genommen hat und mich dann auf Russisch was gefragt hat, was ich ihr nicht wirklich beantworten konnte. Dann hat sie ein bisschen telefoniert, mich eigentlich nicht mehr angeschaut und ich hab mir nur gedacht, wie sowjet-kafka ich hier verwaltet werde. Wie authentisch! Sie hat dann einen Rückruf bekommen und schnell meinen Pass durchgeblättert und mich nach Russland hineingestempelt. Was ich nicht ganz verstehe, weil ich mich ja eh nur im Transitbereich aufhalten darf ohne Visum. Aber natürlich freu ich mich auch ein bisschen darüber, da einen Stempel hineinbekommen zu haben. Novosibirsk drängt sich doch auf in meine Reiseberichte aufgenommen zu werden und wenn ich nur irgendwo am Flughafen rumlungern werde, beschallt mit Nena (99 Luftballons), Ace of Base (Wheel of Fortune), Cindy Lauper (Girls Just Wanna Have Fun) et al., fein synkopiert mit etwas leiserem Russischpop aus dem Café daneben. Bis sie mich morgen nach Eriwan schupfen.
Rettungsschwimmer
Na denn. Ich war sehr überrascht, wie viel Stress mir eine simulierte Rettung macht. Weil ich die Stress and Rescue Ausbildung mach und da waren wir heute im Meer. Am Anfang hat der Marcus ein bisschen Panik unter Wasser simuliert, das ging ja noch. Da weiß man zirka was zu tun ist, da beruhigt man und stellt Kontakt her. Ich mein, nicht, dass da nicht auch was blödes passieren kann, wenn ich zum Beispiel meine Luft hergebe, wenn sie ihm ausgeht, aber nicht daran denke, dass ich selber jetzt keine Luft hab. Da kann man sagen: der große Fehler ist eigentlich gewesen, dass ich meine Luft angehalten hab, weil das macht man gar nicht, damit man sich nicht druckbedingt die Lunge beschädigt. Aber natürlich merkt man eher, dass man plötzlich keine Luft hat. Das ist so ein Ding irgendwie, da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass es nicht nur möglich ist, unter Wasser zu atmen sondern ein Muss und dass es mir sofort seltsam aufstoßen muss, wenn ich nicht atme unter Wasser.
Wirklich Stress ist dann allerdings, wenn ich die Joanna hab suchen müssen, unter Wasser und sie hochholen und zum Boot bringen und auf s Boot bringen und Herzmassage und beatmen und dann heißt s irgendwann von hinten, passt schon, Patientin atmet. Jetzt also Sauerstoffmaske drauf und stabile Seitenlage und dann erst einmal entspannen. Das hat keine Fünf Minuten gedauert alles, aber ich war danach eine halbe Stunde mindestens mit Adrenalin geschwemmt… Jetzt noch, das war vor drei, vier Stunden, jetzt noch bin ich ein bisschen zittrig. Vielleicht mag man sich das überlegen, einen Erste Hilfekurs zu belegen statt in der Hochschaubahn zu sitzen. Natürlich einen mit Praxisteil. Und jetzt hatte ich s quasi eh einfacher, weil ich bin davor von der Joanna gerettet worden und da hab ich ja nur liegen müssen und das über mich ergehen lassen, dass ich der simulierten Notsituation halber etwas grob auf s Deck gehievt worden bin. Da konnte ich ja quasi zuschauen, was es alles zu tun gibt, was sie vergisst, wo ich mir vornehme, was anders, was besser zu machen. Aber dann erstaunlich stressig eben.
Und gestern bin ich mit der Zehe an so einem Betonboller hängengeblieben, die hier einen Gehsteig improvisieren. Oder einen Fahrradweg. Oder einen Kanal. (Es regnet doch täglich und dann schifft s ganz schön runter.) Da bin ich einfach nicht mit genug Abstand dran vorbei und peng, autsch. Und ich hab s wirklich erst ein paar Stunden später gemerkt, dass das doch etwas heftiger gewesen sein muss. Weil ich bin kurz davor mit dem linken Fuss und der dortigen Kleinen Zehe an einer Hausmauer hängengeblieben, als ich um die Ecke geschlurft bin. Und jetzt erlebe ich sozusagen noch die dunkle Seite von Flip-Flops. Weil natürlich ist da nichts, was bremst, was hält, was absorbiert. Aber links war nix. Rechts hingegen eben zwei Stunden später, sitz ich im Restaurant und lass den Regen passieren und beim Rausgehen merke ich, ich humpel lieber ein bisschen. Daheim hab ich erst einmal ein Wasser in die Eiswürfelbox gemacht. Weil ich wohne ja luxuriös mit Kühlschrank und Gefrierfach im Kühlschrank. Und dann hab ich in der Nacht quasi den Eiswürfelbeutel auf dem Zeh gehabt. Auch wenn das Problem natürlich ist, dass es mehr die Innenseite des Zehs ist, die ich mir da vermutlich verstaucht hab.
Für die simulierte Stresssituation und den dadurch ausgelösten Stress hab ich mir die Kleine Zehe dann an die… nun, an die daneben geklebt. Nicht, dass ich Schmerzen gespürt hätte, wenn ich sie gehabt hab, ganz ehrlich. Aber das war schon gut, weil ich hab heute in der Früh bisschen simuliert, wie ich in die Flossen steige und da ist mir ein bisschen der Phantasieschmerz durch die Gehirnwindungen gezuckt, so schmerzhaft hab ich mir das vorgestellt. Und das war sicher besser durch die Pseudoschiene, die der zweite Zeh von außen meiner Kleinen Zehe geboten hat.
Egal. Ich komm nachhause, nachdem ich ein bisschen im Restaurant gesessen bin, um den Regen passieren zu lassen, und hab mir gerade eine Folge Paulchen Panther angedreht, derweil ich mir wieder Eis auf den blauen Zeh lege. Es gibt nämlich ausführlich deutsche Folgen Paulchen Panther im Internetfernsehen. Und Paulchen Panther ist ja sowas, wo man sagen muss: es hat sich total ausgezahlt, dass man im deutschsprachigen Raum damit angefangen hat, zu synchronisieren. Weil stell dir vor, im englischen Original gibt s keinen Sprecher, der in schönen Gedichten die Handlung begleitet. Da ist einfach nur Musik drüber. Wer will denn sowas!?*

Jedenfalls bin ich da an der obrigen Titelsequenz hängengeblieben. Zunächst, weil der Text meinen Augen vorgegaukelt hat, dass Harry Potter in der Produktion seine Hände mit im Spiel gehabt habe. Aber dann hab ich erste entdeckt, welche Rolle der Harry in der Produktion übernommen hatte: er hat dort den Coördinator gemacht. Und das ist ja technisch gesehen, gar nicht falsch geschrieben. Aber diese Schreibweise in einem Artikel oder anderen öffentlichen Text zu verwenden, das wäre schon eine größere Pflicht. Also eine Pflicht-oder-Wahrheit-Pflicht.
Jetzt hab ich noch ein bisschen darüber nachgedacht, wie super Paulchen Panther nicht nur als Sendung ist, wegen der genialen Verse auf der einen Seite, aber dann auch was für ein großartiger Protagonist das Paulchen ist. Weil er ist ja moralisch oft ein bisschen ambivalent ist, manchmal gierig, manchmal jähzornig, nicht einmal immer sympathisch, meistens aber so-oder-so liebenswert. Und er wohl von Sketch zu Sketch ein bisschen unterschiedlich daher. Vielleicht will das jemand einfach „inkonsistent“ nennen und möchte dann eventuell argumentieren, dass mehr seine Einzigartigkeit als rosaroter Panther seine Person zusammenhielte, als tatsächliche Charaktereigenschaften. Aber das wäre eine Person, mit der man nicht unbedingt seine Zeit verbringen möchte, geschweige denn Kirschen essen. Aus dem Wasser holen würde ich sie aber jetzt dennoch können.
*) Niemand.
Frisches Brot
Nachdem ich die letzten zwei Wochen mein Gereise mit FreundInnen geteilt habe, hat mich ein bisschen ins Hinterher gebracht. Es ist nett, die Zeit nicht allein zu verbringen, jemanden zum Plaudern und Reflektieren zu haben, da brauch ich vielleicht auch weniger das Hinsetzen-und-drüber-Nachdenken. Und auch beim Spazierengehen ist mir dann eher ein aktuelles Gespräch im Kopf (und im Mund), als dass mich so ein fremdes Land einfach voll trifft. Und dann brauch ich vielleicht jetzt sogar im Gegenteil ein bisschen wieder das Reinkommen-ins-Hinsetzen-und-drüber-Nachdenken. Außerdem bin ich zuletzt von Korea auf die Philippinen geflogen und ich muss sagen, dass mich das Wetter ein bisschen mitnimmt. Herhaut. Es ist so heiß, wurscht ob tags oder nachts, es ist einfach zu warm. Und natürlich schwül und drückend. Wieder einmal fällt mein Widerstand gegen Klimaanlagenbenutzung innerhalb weniger Stunden.

Und nicht zuletzt natürlich der Kulturschock wieder einmal. Wobei ich gar nicht weiß, ob das das richtige Wort ist. Was ist das richtige Wort dafür, wenn man über Nacht in einem Land ankommt, wo einem bei jedem Augenaufschlagen das globale ökonomische Ungleichgewicht in den Schoß tritt? Es ist nämlich schon ein bisschen wild hier. Mein erstes Erlebnis diesbezüglich war, als ich gestern die Straße entlangspaziert bin, dass ein Bub aus einer mir entgegenkommenden Kindergruppe ausschert und ich seinen Zuruf als Good Morning! verstehe. Die PhilippinInnen scheinen ihr Good Morning! zu lieben, als ich um halb zwei in der Früh aus dem Flughafen gestiegen bin, haben sie mir alle ein Good Morning! zugerufen, während ich gedacht hab, meint s ihr das ironisch oder was soll das. Meinen sie nicht. Und auch nicht ironisch hat der Bub gemeint, als er mir mit ausgestreckter Hand mein Missverständnis auf Money! ausgebessert hat. Da muss man einfach durch. Natürlich hab ich zuerst einmal das Gefühl, dass alle meine Interaktionen mit Einheimischen vom Geld geprägt sind. Wenn man mich im Hotel fragt, was meine Pläne sind, dann hat sie schon einen Plan für mich. Wenn mir die Männer aus dem Schatten einen Gruß zuwerfen und mich fragen, wohin mich meine Beine tragen, dann folgt kurz darauf ein Angebot zum Island Hopping oder eine andere lokale Version von Want to see the ruins, my friend? anbieten. (Ich denke, wie sich kürzlich herausgestellt hat, bei dem Filmtitel Arrival immer noch an The Arrival mit Charlie Sheen. Immerhin geht s in beiden um Außerirdische geht, die auf der Erde landen. Aber während der von 2016 ein guter Film ist, der auf einer empfehlenswerten Kurzgeschichte basiert, hält der Eindruck des zwanzig Jahre älteren vor allem, weil er diesen im formelastischen Lehm meiner jugendlichen Seele hinterlassen hat.)
Aber es geht. Ich muss das ein bisschen vergessen… nein, akzeptieren und darüber hinwegsehen. Und das hab ich ja noch aus Indonesien im Gehirngedächtnis. Das soll gar nicht so tautologisch klingen, ich mein so was wie das Körpergedächtnis, aber halt im Sinne von Geisteshaltung, in die ich leichter zurückfinde. Es ist allerdings fast ein bisschen schade, hab ich mir gestern noch gedacht, dass mein Eindruck von den Philippinen jetzt von diesem einen Ort geprägt wird und ich kann natürlich überhaupt nicht sagen, ob das überall so ist. Dass der Dreck und der Rost und der Sperrmüll so präsent sind. Dass neben der Straße Hähne und Ziegen zwischen dem Plastikmüll und den schlafenden Hunden herumstehen. Dass die Geschäfte schon wieder so viel Fertigessen in Kleinstverpackungen verkaufen. Das macht schon alles ein Bild, vor dem man als mülltrennende MitteleuropäerIn mit Sozialstaatsträumen ein bisschen verzweifeln kann. Aber dann bin ich heute an zwei Mädchen vorbeigegangen, die auf der – for lack of a better word – Terrasse gelegen sind, offensichtlich über ihre Hausübungen gebeugt, singend, miteinander blödelnd. Da hab ich gleich das Gefühl, da geht ja doch was in die richtige Richtung.

Na und heute war ich dann schon eine Runde Tauchen, deshalb bin ich ja hier. Und da bin ich dann in einem Kontext, in dem ich mich ja eh schon der Rolle der GeldausgeberIn eingefunden hab und dann ist auch der Umgang entspannter. Natürlich ist ein Tauchgang für zwanzig Euro geschenkt. Aber dafür muss ich auch zu Fuß vom Strand ins Meer gehen. Unter Wasser sieht man auch, dass bis vor einigen Jahren hier ebenfalls der Sperrmüll entsorgt wurde und auffällige Rohre, die tief in die Lagune hineinführen. Allerdings ist allein an der hiesigen Tauchgeschäftdichte erkennbar, dass der Ozean mittlerweile als eine Ressource verstanden wird und das ist alles bereits ganz gut mit Algen überwachsen. Was gab s also besonderes? Nun, ein paar Schnecken hab ich gesehen und zwar sogenannte nudibranch oder dann auf deutsch mit ein wenig weniger mysteriöser Erotik: Nacktkiemer. Find ich gleich einmal sehr, sehr lässig. Ich hab ja nicht gewusst, nach was ich hier Ausschau halte, deshalb hat s ein bisschen gedauert, bis ich die Zeichen vom Tauchtypen verstanden hab, wenn er mich auf was aufmerksam machen wollte. War schon aufregend, in einem neuen Gewässer zu tauchen. Wenig überraschend war hingegen, dass die Kamera nach zwei Fotos den Geist aufgegeben hat, da dürfte einfach die Software abgestützt sein.
Oft ist man ja einmal mit der Situation konfrontiert, ob man jetzt noch das alte Brot aufessen soll, obwohl man gerade mit einem frischen Laib durch die Wohnungstür gestiegen ist. Natürlich ist das ein Problem für Gesellschaften, in denen Brot eine wichtige Rolle spielt und insofern schon einmal ein Gleichnis, dass für Ostasien relativ unpassend scheint. Ich hab nicht vor, zehn Tage Japan, fünf Tage Korea zu unterschlagen. Aber für jetzt erst einmal was aktuelles.
Baba, Pape’ete! Tadaa, Tokio!
Es stimmt schon, ich hab mit einem Kulturschock gerechnet. Ich hab mir gedacht, der Unterschied zwischen einsiedeliger Inselidylle und halbautomatisierter Millionenstadt wird mich irritieren. Aber so sehr hab ich mich in den paar Wochen auch wieder nicht dran gewöhnt, immer nur die selben zehn Gesichter zu sehen. Ich war ja auch in Pape’ete im Einkaufszentrumsäquivalent und da sind auch viele verschiedene Leute zu sehen. Dass die Autos wieder auf der anderen Straßenseite fahren, habe ich mehr oder weniger ohne bewusste Entscheidung akzeptiert. Nein, womit ich mir ein bisschen schwer tu, ist der Schalter, den ich von Liegen wieder auf Laufen zu schieben versucht bin. Tahiti hat mich willkommen geheißen, wie ich es nicht erwartet hätte. Ich bin getaucht, ich hab gekocht, ich hab Leute gekannt… ich war manchmal ein bisschen überfordert, wenn ich auf französisch was sagen sollte oder wenn ich einem Gespräch folgen wollte. Ich bin meiner Tauchverpackung für den Fotoapparat hinterhergelaufen. Aber wenn ich erschöpft war, hab ich mich hingelegt, wenn ich aufgewacht bin, bin ich aufgestanden. Wenn ich spazieren gegangen bin, hab ich mir Sonnencreme draufgeschmiert. Und wenn ich was neues wollte, bin ich eine Woche auf die Nachbarinsel gefahren. Es war wirklich ein gemütliches Arrangement.

Ja, hänge ich dem ein bisschen hinterher. Und es hat ja auch gleich ein bisschen so ausgeschaut, als wollte mich Französisch Polynesien nicht loslassen. Der Benjamin (-scha’möö) hat mich morgens um fünf zu meinem sieben Uhr Flieger geschupft, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Weil zuerst hab ich recht lang am Eincheckschalter gewartet und als ich dann dran war, hat mir die Frau Schalterbeamte gesagt, dass sie mich nicht einchecken kann, wenn ich nicht einen Flug wieder raus hab, aus Japan. Und ich denk mir na geeeh. Der Flughafen Faa’a hat nicht mal eine Flughafenhalle, der hat wirklich nur ein Vordach und dann einen Duty-Free Bereich mit einem kleinen Café und all den Perlen, die sonst niemand gekauft hat. Und so steh ich also vor Sonnenaufgang und mit einer halben Stunde Gratisinternet vor dem Flughafen und ärger mich mit der Website von der koreanischen Fluglinie, weil es beim dritten Versuch noch immer nicht funktioniert hat, mir einen billigen Flug nach Seoul zu kaufen. Ich hab dann über lastminute.de und innovative Zahlungsmethoden den Flug ums doppelte gekauft. Sind immer noch nur achtzig Euro gewesen und ich war froh, dass das am Schalter dann für ein OK gesorgt hat. Hätte ich mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht, dann wäre mir vielleicht sogar eine billigere Route eingefallen. Weil – psst! – das ist nur für Show, ich werde den Flug einfach verfallen lassen. Ab und zu muss man so eine zusätzliche Abgabe leisten, wenn man seine Pazifikquerung so nebenher einkauft. Und natürlich sagt das Außenministerium sehr wohl, dass ich ein Rausflugticket brauch. Aber das war bei Neuseeland, da hab ich mich ja informiert. Bei Japan hab ich so einen Kommentar sogar gesucht und wiederholt nicht gefunden. Aber ich mein, was soll ich das der Angestellten am Eincheckschalter kommunizieren versuchen. Es ist natürlich belanglos in der Situation. Computer says no – presumably.
Jetzt hat mir Tokio die ersten zwei Tagen wie gesagt verhältnismäßigen Stress gemacht. Eben aus dem Gefühl heraus, hier mit den TouristInnenaufgaben konfrontiert zu sein. Dass ich da in den richtigen Modus komme. Oder raus aus dem falschen. Es gäbert so viel zu sehen und gleichzeitig hab ich so wenig Ahnung, was ich sehen wollen würde. Ich bin ja eigentlich schon wieder hier wie wenn man mich in den Flieger gesetzt hätte und Ab die Post! in die Ferne katapultiert. Das ist heute schon ein wenig besser geworden, weil ich ein paar TouristInnensachen gemacht hab. Schrein besucht. Kreuzung gequert. Schnitzel gegessen. Was man halt so macht, wenn man in Tokio ist. Und mein erster Ausflug auf den Berg ist auch geplant. Hakerl gesetzt, alles auf Schiene. Ich bin deshalb heute tatsächlich mal bisschen aufgeschreckt in der Nacht, dass ich da wieder auf mich gestellt bin und Hostel buchen und Routen überlegen. Tsk, tsk. Ist doch Urlaub, hab ich versucht mir zu sagen. Und ich hab vielleicht bisschen mit den Schultern gezuckt und bin dann schnell wieder eingeschlafen. Dass ich Mitte September zum Wählen einen Sprung in Tokio sein soll. Aber dann hab ich gesehen, dass ich im schlimmsten Fall einen Tagesausflug mach, weil zwischen Osaka und Tokio ist es zwar die halbe Honshu, aber trotzdem nur zweieinhalb Stunden mit dem schnellen Zug. Alles also nicht so heiß gegessen wie die Ramen: drei Tage da und schon zweimal Gaumen verbrannt.

Ich bin auch gar nicht besonders in der Stimmung zu schreiben, merke ich. Da ist schon eine allgemeine Überforderung. Dabei gäb s von den Windseitigen Inseln noch so viel zu berichten. Wie ich zum mo’oreanischen Belvedere hochgeradelt bin und gegen Ende schon alle zweihundert Meter eine Pause hab einlegen müssen. Aber für die Aussicht auf die schöne Aussicht dann doch durchgehalten hab. Und mich dann auf der Wanderung im Ananasfeld verlaufen hab. Oder wie ich im Vallée Blanche mit den Haien getaucht bin und so viel auf die vermutlich katalonischen TouristInnen herabgeblickt hab, weil die derart aufwendige Fotoausrüstung mitgebracht hatten. Und wo der Philippe nachher gesagt hat, dass ich eine gute buoyancy hab, auch wenn ich erst wenig getaucht bin. Oder dass wir tatsächlich eine Verabschiedung gefeiert haben, zu der ich eine Sachertorte gebacken hab, deren Glasur nicht so schlecht geworden ist. Dass alles ein bisschen zu kurz gewesen ist. Und über dieses Gefühl, jetzt wieder aufgebrochen zu sein, nachdem ich eine Art zuhause gefunden hab, in dem ich mich so wohl gefühlt hab, wie vielleicht seit Jahren nicht.

Das drückt alles vielleicht auch ein bisschen auf meine ersten Japaneindrücke, dass ich das Gefühl habe, ich bin ohne besonderen Grund und übereilt aus Tahiti abgereist und wie organisier ich mir das, dass ich da bald wieder einmal zurückkehre. Jetzt muss Japan das aushalten, ständig verglichen zu werden. Und ich, der ich gerade noch sozial gut eingebettet, wenngleich sprachlich eingeschränkt gewesen bin, fühle vielleicht dadurch ein bisschen mehr Fremde und Verlorenheit in dieser Gesellschaft, in der allen Vorurteilen zufolge, viele Einheimisch ebenfalls mit der sozialen Isolation kämpfen. Das erste Bild, das sich mir als „japanisch“ eingeprägt hat, waren die ordentlichen Reihen der Reisfelder, die ich schon aus dem Flugzeug und eine Stunde später auch aus dem Zug in die Stadt gesehen habe. So ordentlich, dass es fast ein bisschen wehgetan hat. (Zumindest wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass das eigene Bedürfnis nach Ordnung ab einem gewissen Grad etwas schmerzhaft sein kann.)
Im Hostel aber dann weiterhin: so ordentlich. Sehr viele Warn- und Verwendungshinweise, bebildert und japanisch beschriftet. Ich frag mich dann immer, ob mir das stärker auffällt, weil ich s nicht verstehe und deshalb mehr darauf konzentriere oder ob es das bei uns einfach weniger gibt. Vielleicht hatte ich sogar den gleichen Gedanken bereits in Indonesien. Obwohl das schwer vergleichbar ist… Und der Schlafsaal war vielleicht der ordentlichste, den ich je erlebt hab. He!, in Mo’orea haben sie sogar Wände zwischen den Betten hochgezogen und hier schlaf ich im Stockbett. Aber ich krieg mit Vorhängen und Benehmen (auch dafür gibt s schnell einmal ein paar Schilder) von meinen MitbewohnerInnen so wenig mit, ich weiß kaum, mit welchen sieben anderen Leuten ich überhaupt das Zimmer teile. In der minimalistischen Gemeinschaftsküche ist Platz für Handtücher für die Hände, Handtücher für die Tische, Handtücher die eigentlich Geschirrtücher sind.

Ja, es ist a neurotic’s paradise und da wehrt sich alles ein bisschen in mir. Schön und überraschend schön in seiner schlichten Eleganz ist es natürlich trotzdem. Und Bewunderung für die U-Bahn, die ich nicht einmal zu verstehen versuchen muss, weil mein Maps mir sagt, welcher Bahnsteig, welcher Waggon, welche Station und welcher Ausgang. Ich kann nur annehmen, dass jemand vor zehn Jahren einen Tag lang planen hätte müssen, bevor sie die U-Bahn benutzen wollten. Nicht, dass nicht auch die Stationen mit Informationen zugepflastert sind. So überlässt man es beispielsweise nicht dem Zufall, wo die NutzerInnen entlanglaufen, die Pfeile am Boden sagen, dass man sich links halten soll. Außer manchmal, wenn man sich rechts halten soll. Und ich versteh nicht, warum, aber warum auch, ich tu, was mir die Pfeile sagen. Manchmal sagt mir eine Fußbodenbeschriftung auch, dass ich während dem Gehen nicht rauchen oder mit meiner Handheld Device spielen soll. Dann steck ich das Handy tatsächlich weg. Ja, man muss schon ein bisschen aufpassen im Straßenverkehr, nicht zuletzt, weil in den Seitenstraßen eigentlich keine Gehsteige sind, manchmal Markierungen. Und das gefällt mir, das macht aus jeder Gasse eine Begegnungszone. Es ist erstaunlich, wo in einer Gesellschaft, die so viel für einen geregelten Ablauf sorgt, sich plötzlich eine relative Leerstelle auftut, die bei uns daheim für Chaos oder zumindest eine Menge grantiger Leute sorgen würde.
Für Ordnung hingegen sorgen hier hunderte PensionistInnen in Uniform. Zumindest wirken sie so. Bei jeder Baustelle, bei einer komplizierten Ausfahrt stehen oft einmal zwei, drei Personen mit Helm und Insignien des Sicherheitspersonals und wedeln mit ihren Signalstaberln herum um jemandem die Ausfahrt oder Überquerung zu ermöglichen. Und das ist wiederum erstaunlich, weil ich das für in Europa einfach nicht für leistbar halte. Auf der anderen Seite handelt es sich dabei oft um ältere Personen, ich gehe also wirklich davon aus, dass sich hier jemand die Pension aufbessert.

Also ja. Alles fremd. Morgen geht s auf den Fuji und dann in einem Aufwischen wieder runter. Weil sich s anders nicht ausgeht. Das heißt früh aufstehen und neun Stunden Wanderung. Sechs rauf, drei runter. Und wenn s nur für zwei Tage ist, ich bin ganz froh, einmal einen Blick von Japan außerhalb von Tokio zu bekommen. In so einer Großstadt sind die Isolationserfahrungen schon einmal ganz von selbst etwas extremer.
The world was young, the mountains green…
Nachdem ich Mo’orea zum ersten Mal so ausgesprochen hatte, wie die FranzösInnen das tun, den Akzent also nicht auf s e gelegt hab, sondern auf das in der Praxis zusammengezogene o’o, hab ich s nicht mehr aus dem Kopf bekommen, wie sehr das nach Durins gefallener Festung klingt. Aber es ist kaum der finstere Abgrund, den uns Tolkiens Etymologie von Moria glauben lassen möchte. Mich auf die besungene Hochzeit Khazad-Dûms beziehend, gibt es hingegen auf jeden Fall eindrucksvolle Berge und grün sind sie auch. In der Praxis sind meine Versuche, das fotografisch festzuhalten, leider bisher gescheitert. Ich bin allerdings wirklich ab und zu hingerissen genug, um auf der Straße stehen zu bleiben um an den Straßenrand zu fahren und vorsichtig anzuhalten um mich umzuschauen und festzustellen, wie toll das aussieht.

Ich bin am Dienstag nach Mo’orea aufgebrochen. Das ist die Nachbarinsel von Tahiti, ein schönes Stück kleiner und auch gelassener, wie die Reiseführer gerne sagen. Ich erlebe es jetzt vor allem einmal als touristischer, aber das ist wohl einfach weil alles ein bisschen enger beieinander ist und sich auf der Straße die Einheimischen, die Hilton- und Sofitel-Leute sowie die Rucksackmenschen einfach mehr mischen. Das fällt zum Beispiel auf, wenn mir auf der Straße ein Konvoi Quadbikes mit fröhlichen TouristInnenpärchen entgegenkommt. Oder Familien die sich in Golfbuggies den Weg bahnen. Das ist ein bisschen seltsam, weil irgendwie ist dadurch die ganze Insel ein einziges Ressort, wenngleich halt so offen, dass alle in dem Ressort Platz haben.

Ob es auch für mich ein bisschen mehr Urlaub ist, insofern, als dass ich mir hier jetzt mehr Freizeitaktivitäten organisiere als ich das auf Tahiti gemacht habe, das kann ich nach dem zweiten vollen Tag noch nicht wirklich sagen. Es gibt ein Belvedere, für das ich ein bisschen in den Berg hineinsteigen muss und dann eine kleine und eine große Runde mit schönen Aussichten und bisschen Tropen. Und es gibt Schnorcheln und Kayaken und Badestrände. Ich bin auf jeden Fall nur mit Minimalgepäck unterwegs und habe den Rucksack bei den MitbewohnerInnen auf Tahiti gelassen. Das ist schon ein ziemlicher Qualitätsunterschied! Ad Freizeitgestaltung hab ich mir jetzt einmal ein paar Tauchgänge organisiert, besonders beworben werden die ansässigen Zitronenhaie, von denen es einen Haufen geben soll. Auf Tahiti hab ich hingegen letztens einen Grauhai nur verpasst. Die Lisa hat nach mir gerufen, aber wenn ich fünf Meter entfernt bin und in die andere Richtung schau, ist es unter Wasser nicht so einfach, meine Aufmerksamkeit erregt zu bekommen. Endlich Blickkontakt hat sie mir noch in die Richtung gedeutet, aber es hat dann noch eine halbe Stunde gedauert, bis ich sie fragen konnte, was sie mir da eigentlich deutete, weil zu sehen war nichts mehr gewesen. Außer das Meer.
Und da hab ich bei einem anderen Tauchgang hineingeschaut, so, dass ich nur Blau gesehen hab, keinen Boden, keine Oberfläche. Da ist mir schon etwas schwummrig geworden und ich hab mich bemüht, meine 360° schnell fertig zu drehen, damit ich wieder die Wand im Blick hab, neben der wir entlanggetaucht sind. Es ist schon seltsam, mit so einer unspezifischen, unstrukturierten Unendlichkeit konfrontiert zu sein. Und natürlich kann man das auch schnell einmal auf das Leben ummünzen, wenn man meine Reaktion, mich schnell davon abzuwenden, in eine Form gießen möchte. Im gleichen Tauchgang hat uns übrigens auch ein Barrakuda verfolgt, der war sicher zwei Meter lang. Und hier war s dann eher ein Segen, dass wir uns unter Wasser nur schwer verständigen können, weil der Gaylord hat dann gesagt, er hätte ihn vertrieben, der sei einfach zu nahe gekommen. Unschuldslamm, das ich bin, hab ich natürlich nicht geahnt, dass es sowas gibt, wie „der Barrakuda zu nah“. Ich hatte durchaus ein bisschen Bauchmulm, als der ein paar Meter entfernt dann vorbeigeschwommen ist. Aber gleichzeitig hab ich mich an dem Gedanken festgehalten, dass alle Gefahren statistisch sicherlich unwahrscheinlich seien, zum Beispiel dass der große Fisch mit den langen Zähnen jetzt mit der Aggression anfängt. Jetzt weiß ich natürlich, dass die Wikipedia darauf hinweist, dass „[d]ie großen Unterkieferzähne der Barrakudas […] schwere Wunden [reißen], die zu großem Blutverlust führen können“. Nachsatz: „Sie beißen allerdings nur einmal zu und schwimmen dann weg“. Manchmal bin ich schon ein bisschen gespannt, was es zum Beispiel im Traunsee alternativ zu tauchen gibt.
Und ja, leider leider hab ich es in den Gegenden, wo mir ständig das Tauchgehäuse für meine Kamera angeboten worden ist, durchgehend vermieden, ein weiteres sinnloses Accessoire einzukaufen. Na, jetzt ist das natürlich nirgendwo zu kriegen und ich mach keine Fotos mehr von Unterwasser. Dabei wär ich jetzt langsam aber sicher doch in einer gewissen Routine, in der ich Auftrieb und Atmung beisammen hab und eben auch einmal ein bisschen in der Gegend herumschau, um einen Fisch oder eine Schildkröte zu beobachten. Ich darf im Logbuch ja auch Exploration anstelle von Instructional ankreuzen. So hab ich mir zur Kompensation halt einen Tauchcomputer gekauft, den ich am Samstag zum ersten Mal mit unter Wasser nehmen werde und der mir dann sagt, wie viel Stickstoff ich noch im Blut hab und wie lang ich nicht fliegen darf, dass er mir nicht Blasen im Blut wirft.

Ja, eigentlich wäre ich ja gerne auf die Tuamotus geflogen. Das ist so eine Gruppe von Atollen, etwa eineinhalb Stunden nordöstlich von Tahiti. Aber man glaubt s kaum: ich hab drei Tage vor meinem erhofften Flug keine Unterkunft gefunden. Dabei ist bloß Hochsaison. Und vielleicht hätte ich ja sogar noch was gefunden, aber nach dem unteren und ausgebuchten Preissegment kommt erst einmal länger nichts. Na, da war ich dann kurzerhand froh, dass ich meine Flüge auch nicht gekauft hatte. Schade, aber natürlich ist das in meiner Verantwortung, wäre ich die zwei Wochen nicht auf der mal helleren, mal röteren, mal fast akzeptabel gebräunten aber stets erkennbar faulen Haut gelegen, wäre sich da durchaus was ausgegangen. Next time you know, hat mir ein David gesagt und da hab ich s ihm noch nicht geglaubt, dass er recht behalten wird.
Natürlich, ich bin vor allem herumgelegen, wenn ich nicht tauchen war oder auf dem Weg zur Marina, aber es ist ein entspanntes Herumliegen. Das geht ein bisschen in die Psychologie des Getrieben-Seins, des Eigentlich-tun-Sollens. Wahrscheinlich wäre es – jetzt ein bisschen weiter zurückblickend – gut gewesen, ein wenig früher einmal aus dieser Situation herauszukommen, wo ich nicht ständig in der Lage bin, eigentlich an einer Diplomarbeit, an einer Dissertation sitzen zu müssen. Seminararbeitenschreiben, Hausübungenerledigen, Klavierüben, Großelternanrufen. Ständig hätte es was zu tun gegeben und ich mich sehr daran gewöhnt, zum täglichen Herummuddeln eine Portion schlechtes Gewissen serviert zu bekommen. Das geht dann auf Kosten der intrinsischen Motivation, wenn ich mich so häufig und vor allem stetig im Müssen-Sollen finde, anstatt im Wollen-Können. Interessanterweise würde ich sagen, dass es auch das Können-Wollen letztlich beschädigt oder zumindest dass wenn für das Können so viel Müssen notwendig scheint und sich der Widerstand gegen das Sollen aufstaut, dann entrückt das Ziel und das Wollen verliert als Ganzes ein bisschen den Anschein des Möglichen. Und, ja, dürfen hab ich mich getraut. Aber das zeigt uns auch nur, dass ich meine Probleme nicht erfunden hab. Da ist es schon auch ein Erfolg den Atollausflug sausen zu lassen und zu vielleicht einfach anerkennen, wie sehr ich auch von hier tatsächlich hingerissen bin. Alles nicht so einfach.
Ja, weil. Es ist halt wirklich schön. Weil, ich mag die ganze Strandgeschichte immer noch nicht. Ich war einmal in Australien baden, erinnere ich mich. Also. Ich bin ins Meer gestiegen, hab mich mit den Wellen geärgert, bisschen ein Unwohlsein ob dem offenen Meer bekommen und bin nach drei Minuten wieder raus. In der Zeit hab ich mir sicherlich einen Sonnenbrand geholt. Ist also nicht meins. Mich am Strand in die Sonne zu legen kommt mir immer noch etwas seltsam vor. Aber mit dem Tauchen hab ich einen ganz guten Zugang zum Meer gefunden. Und wie sehr die Tropen mir als Paradies eindoktriniert worden sind oder ob die orangengroßen Maracujas (immer wieder die Maracujas), die ich aus dem Straßengraben geklaubt habe, nicht auch einfach die Freude daran, am Wegesrand Brombeeren zu pflücken um den Volumsunterschied potenziert, ist schwer zu sagen. Aber das Licht hell ist und der Himmel blau. Die Palmen, Früchte, Blüten. Die Blumen im Haar und der ausgeprägte Vokalismus in der Sprache (nur neun Konsonantenphoneme!). Und das in Kombination damit, dass selbst die Tortillastandlerin einen Champagner im Cola-Kühlschrank stehen hat und anderswo auf der Karte mehr Wasser zur Auswahl stehen als Bier. Ich finde das charmant.

Meiner vielleicht neugefundenen Entspannung liegt natürlich auch diese sich mir langsam eröffnende Frankophilie zugrunde. Sprachlich gesehen bin ich immer noch eingeschränkt, wobei ich auf Mo’orea auch selbstbewusster Leute auf Englisch anspreche, während ich auf Tahiti mehr gefordert war, Französisch zu sprechen. Und so konnte ich mich dann in Situationen oft kaum einbringen, aber vor allem letztlich auch nicht rausreden und nicht in der Lage mich aus einer Lage herausblödeln oder einfach ins Plappern zu verfallen. Gespräche sind harte Arbeit. Und selbst wenn ich mich mit jemandem unterhalte, die französisch können, war s in der Regel eine gemäßigte Unterhaltung, weil dann halt das Englisch für mein Gegenüber oft nicht super easy war. Für mich, der ich oft mehr rede weil das Reden lustig ist, ist das eine interessante Abwechslung, mal ein bisschen meiner sozialen Fluchtoptionen beraubt zu sein.

In other news hat zuletzt auch die letzte kleine Katze ein neues Zuhause gefunden und die verwirrte Katzenmutter ist zwei Tage lang rufend durch die Gegend gelaufen. Das ist schon ein bisschen herzzerreissend, wenn man sich die Biologie da anschaut. Aber so ist das wohl. Es war dann auch schnell wieder vorbei. Auf der anderen Seite leben die Kleinen zumindest, auch wenn das für die Katzenmutter natürlich nicht verständlich ist, dass das gerade gut ausgegangen ist für die nächste Generation. Mit etwas Glück – aber das ist jetzt wieder mehr meine Meinung als feline Glückseligkeit – werden sie in ihren neuen Haushalten sterilisiert. Von wegen Verantwortung für ein Haustier übernehmen war da auch noch ein Kater, der ebenfalls in der Nachbarschaft seine Runden gedreht hat. Ganz instinktiv hab ich mir immer gedacht, der würde ja auch von irgendwo kommen und irgendwohin zurückkehren, aber wenn das bei den hiesigen Hunden schon nicht immer klar ist, dann bei Katzen wohl umso weniger. Jedenfalls hat der ein kaputtes Bein oder was, und humpelt dementsprechend bereits ein wenig bemitleidenswert durch die Landschaft. Vor allem wo die Christine ihn in der Regel verscheucht, wenn er sich zum Beispiel des Essens, das sie den Kätzchen rausgestellt hat, habhaft machen wollte. Also emotional hochkomplex die emotionalen Schattierungen des Katzenalltags. Jetzt nämlich auch noch, dass der außerdem die halbe Nacht schreit. Aber was weiß man, ob das ob einem gebrochenen Bein ist oder vielleicht aufgrund der tagtäglichen Ablehnungserfahrungen. Oder ob es vielleicht gar eine Poussage ist, für die er sich in der Nachbarschaft hören lässt.
Und als ob der Verlust der Kinder bei der einen und die der Agilität bei dem anderen nicht schrecklich genug wären, bin ich anderntags dann noch einer toten Katze über den Weg gelaufen. Nachdem sie neben der Straße im Schatten eines Buschs gelegen ist, hab ich mir gedacht, dass sie wohl eine umsichtige AutofahrerIn noch auf den Straßenrand geschleudert haben wird, nachdem vielleicht ein bedauerlicher Unfall passiert ist. Am Donnerstag ist sie so dagelegen, da hätte es fast noch sein können, dass sich s da nur eine faule Katze im Schatten gemütlich gemacht hat. Freitag hat man schon gesehen, mehr faulig als faul, wie der Körper ob der Verwesung bereits ein bisschen unförmig wird. Zum Glück (?) hat sich über s Wochenende jemand die Mühe/den Spaß gemacht, der Katze eine Feuerbestattung zu organisieren, drei Meter weiter an der Straßenecke. Die Überbleibsel waren zwar durchaus noch identifizierbar und meine Lungenkapazität hat dem empfohlenen Radius des Luftanhaltens kaum Genüge getan, aber es ist viel besser, als wenn man sie dort ignoriert hätte. Also ja: so hält sich die Katzenpopulation im Gleichgewicht.

Auf Mo’orea sind s unterdessen vor allem die HÜhner die sich aufdrängen. Also Hühner mit Binnen-Ü, weil es nicht zuletzt die Hähne sind, die einen Krach veranstalten. Sagen wir ab zirka fünf in der Früh. Mit einiger Verwirrung hab ich andererseits den hiesigen Hund gestern in der Distanz mit etwas, von dem ich sehr sicher bin, dass es ein Huhn war, aus dem Nachbarsgarten laufen kommen sehen. Begleitet von aufgeregtem Hühnergeschrei und einem etwas verdutzt dreinschauenden Nachbarshund. Aber ist das… ich mein, stiehlt ein leicht übergewichtiger Hund, der sich bei uns durchaus daran hält, dass er nicht auf die Terrasse darf, stiehl, ja: mordet so jemand ein Huhn?
Und in bald einer Woche hab ich jetzt einen Flug nach Tokyo. Weil zwei Wochen vorher ist vielleicht nicht übertrieben, sich das zuzulegen. Noch dazu, wo ich von der Annabelle letztens den Hinweis bekommen hab, dass mir das nächste Jahrhundertereignis einen Strich in die Rechnung macht, indem der Rugbyworldcup zum ersten Mal in Asien stattfindet. Oder zumindest das erste Mal in einem Land, das nicht zu jener Handvoll Ländern zählt, in denen Rugby irgendeine Rolle spielt, also England, Frankreich, Südafrika, Australien und Neuseeland. Im Kontext der hiesigen No-Vacancy-Erfahrungen bin ich da jetzt auf jeden Fall ein bisschen unter Druck geraten. Und gar nicht so sehr, weil ich die Gelegenheit sehe, in einem Rugbystadium zur Sehnsuchtsfindung geschweige denn -erfüllung zu finden, sondern weil ich schlicht nicht mit dem Rugbytourismus um billige Hotelzimmer konkurrieren möchte.

#fragmente
(Nicht, dass der Text bisher besonders einer formalen Struktur entsprochen hätte…)
Witzigerweise sind auffällig viele ItalienerInnen auf Mo’orea. Und ItalienerInnen werden mir, so kommt mir manchmal vor, schon bei einer einzigen Familie auffällig. Irgendwie sind ItalienerInnen einfach nicht wer, die ich irgendwo in der Welt zu treffen erwarte und bin dementsprechend erstaunt, wenn s doch passiert. Außerdem haben sie oft eine besondere Präsenz, wohl auch, weil sie mir nur oder vielleicht auch erst auffallen, wenn sie zu mehrt sind. Schließlich hab ich ja auch das Gefühl, Italienisch eh zu verstehen. Mehr noch als SpanischsprecherInnen beim Spanischsprechen zuzuhören, die in der Regel nicht annehmen, dass ich sie verstehe, komm ich mir beim ItalienischsprecherInnenbelauschen noch ein bisschen mehr Undercover vor. Und dann sag ich trotzdem buongiorno, wenn wir einander in der Früh grüßen und hab sofort das Gefühl, mich verraten zu haben.
In Tahiti bin ich durch den Supermarkt gelaufen und hab einen Wahnsinnsappetit auf Äpfel bekommen. Kann schon mal vorkommen, aber dann hab ich gesehen, dass die wie so viel anderes halt aus Neuseeland importiert werden. Da hab ich mir natürlich ein bisschen an den Kopf gegriffen, weil ich dauernd davon schwärme, wie mir die Tropenfrüchte vom Baum vor die Füße fallen und manchmal dann schon keine Maracuja gegessen hab, obwohl ich eine Maracuja hätte essen können. Geschweige denn Sternfrüchte, von denen es einem schnell einmal langweilig wird, oder Mangos, die wirklich mehr Vogelfutter sind. Und jetzt will ich einen Apfel haben, die Eichnull des Obsts. Hab ich keinen gegessen. Aber zwei Minuten später hab ich einen neuseeländischen Apfelsaft gekauft. Ich hab nix anderes gefunden, nicht gekühlt zumindest. Und interessant da, dass es verschiedene Apfelsäfte nach Apfelsorten zur Auswahl gegeben hat.

Ich hab das letztens mal festgehalten, dass um die Halbjahresgrenze herum jetzt langsam mein Equipment unter der Dauerbelastung nach- und aufgibt. (Stell dir eine Schublade vor, die von einem skandinavischen Schubladenroboter auf- und zugemacht wird. Unaufhörlich.) Das ist psychologisch schon ein Wendepunkt. Meine Sandalen hab ich dann kurzerhand einer Reparatur unterzogen, wobei ich endlich einmal die Ahle auf meinem Taschenmesser verwendet hab. Das war allerdings ein bisschen Mit-Kanonen-auf-die-Spatzen, wo dann eine einfache Nadel auch gereicht hat. Allerdings ist das Leder dann sowieso einfach ein paar Millimeter drunter nochmal gerissen. Und nachdem die Sohlen auch schon lange entzweigebrochen sind, hab sie der Müllabfuhr überantwortet. Dass ich sie jetzt wirklich lange gehabt habe, ich in ihnen bereits kubanische Autobahnen entlanggegschlendert bin, ist sowohl bedauerlich (Mensch-Schuh-Beziehung) als auch tröstlich (KundIn-Produkt-Beziehung). Als Ersatz schlurf ich jetzt in Flip-Flops, was persönlich auch ein großer Schritt gewesen ist und schwups! habe ich davon erst einmal links wie rechts Blasen bekommen.
Und zu hinterst noch Neuigkeiten von ebendort. Ich hab mir auf Mo’orea gleich mal ein Fahrrad gecheckt, weil ist sie mir auf Tahiti ja doch abgegangen, die Mobilität. Jetzt war ich nach meiner Ankunft in FranzPol doch ab und zu ein bisschen verwirrt, wenn ich mal wieder an einer T-Kreuzung gestanden bin, wo denn jetzt der Verkehr herkomme, weil natürlich ist das Land französisch genug, dass die Leute auf der kontinentaleuropäischen Straßenseite fahren. Aber weil das sprichwörtlich wie Radfahren ist, hinsichtlich der Verlernbarkeitsoption, hab ich mich schnell wieder daran gewöhnt und gebe meinen Selbstbewahrungsinstinkten mittlerweile bereits wieder weitgehend freie Handhabe dabei, mich sicher über die Straße zu bringen. Funktioniert auch beim Radfahren, alles kein Problem. Nein, was sich hingegen schnell einmal als eine Schwierigkeit herausgestellt hat, ist möglicherweise auf den Trainingsmangel der eigenen Beckenbodenmuskulatur zurückzuführen. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Sattel einfach unverhältnismäßig schmal ist oder das Gelände unanständig holprig. Fakt ist, ich bin seit einem halben Jahr nicht mehr auf einem Fahrrad gesessen und ich mich jetzt auf meinem VTT (veló tout terrain) herumwinde wie ein Sängerknabe unter Harndruck.
The Tahiti Life
Die Zeit vergeht so vor sich hin und es ist erstaunlich schwer, das in Worte zu fassen. Tatsächlich setz ich mich jeden Tag hin, tipp ein bisschen in diesen Text hinein, streich Sachen raus, bringe Daten und Reihenfolgen up-to-date und mache mir Notizen zu neuen und alten Sachen, die ich hier beobachte, die dann ein neuer Absatz werden. Manchmal merke ich, wie mich das eine oder andere Thema seltsam nachdenklich macht, politisch, fatalistisch oder sonst irgendwie in eine komische Richtung bringt. Das kommt dann in die privaten Notizen. Und so schwimmen die Tage ein bisschen in einander, ohne Rück- und ohne Weiterflug ist mir schnell einmal ein bisschen das Gefühl für die Zeit verloren gegangen. Und nachdem meine Unterkunft so leger organisiert ist und wir seit ich hier bin mehr oder weniger mit der gleichen Besetzung hier wohnen, die Türen sind offen, die letzte dreht das Licht ab… Die anderen gehen ja arbeiten tagsüber, wenn ich aufstehe, ist außer mir oft nur Christine da, die als Künstlerin weniger rigide Arbeitszeiten hat.
So schlurf ich durch das leere Haus und setz mich mit meinem Frühstück auf die Terrasse. Ich weiß nicht genau, wie sekundär da mein Analphabetismus zugeschlagen hat, aber als ich im Geschäft gesehen hab, dass in der Schachtel zweiundfünfzig Sackerl mit Fertigporridge enthalten sind, hab ich noch die Division zum Einzelpreis hin geschafft, aber dass ich davon zwei Monate lang Frühstück hab, ist nicht ganz durchgedrungen. In Wahrheit war ich schon froh, da eine Quelle gefunden zu haben. Ohne Janes Küche in Melbourne hab ich in dem Wegwerfporridge eine zufriedenstellende Lösung des Frühstückproblems gefunden, die ich froh bin, nicht der Veränderung der kulturellen Rahmenbedingungen zum Opfer machen zu müssen. Zugegeben, es ist mehr, dass ich mir nix überlegen muss. Weil was die kulturellen Rahmenbedingungen schon zur Verfügung stellen ist ein Baguette, das ich letztens fast aufgenascht hatte, bevor ich damit daheim angekommen bin, weil das gut gemacht war.
Seit ich mit dem Tauchen angefangen hab, bin ich abends dann auch müde vom Tag. Wobei mich der Sonnenbrand Anfang der Woche am meisten hergerissen hat. Das war auch nicht schön anzusehen, weil ich nicht nur, dass ich ja theoretisch aus dem Winter komme, ich hab ja auch sonst eine schwierige Beziehung zur Sonne. Wer weiß, was ein Witchetty Grub ist, ist im Vorteil, wenn ich mich mit einem solchen vergleiche. Also halb Kellerblässe, halb Sonnenbrand. Solange mir niemand anerkennend auf die Schulter klopft, ist es trotzdem gemütlich. Zum Beispiel weil ich Brownies für die Abschiedsfeier des Portugiesen gemacht hab, was viel besser angekommen ist als das Bananenbrot ein paar Tage zuvor. Butter, Zucker, Schokolade… da braucht man den Leuten nicht mit Obst kommen.

A propos Obst: während ich meine Zeit also verhältnismäßig gelassen im Garten sitzend verbringe, ist mir letztens aufgefallen, wie quasi jeder Baum hier ein mehr oder weniger exotisches Obst trägt. Wenn man s genau nehmen will (und immerhin ist das das Internet, da muss man bei sowas durchaus vorsichtig sein), ist es nicht immer Obst oder nicht immer ein Baum auf dem das Zeug wächst: Bananen und Kokosnüsse, Maracujas, Sternfrüchte (von denen eine etwas überreife mal mit ziemlichem Karacho neben mir vom Baum gefallen und am Boden zergatscht ist), Papayas und Mangos. Die Maracujas haben den Zenit wohl gerade überschnitten, aber vier, fünf gibt s noch jeden Tag, die Papayas ist gerade erst so richtig im kommen. Der Mangobaum hingegen wirkt nicht, als wäre er wirklich für den Ertrag gemacht, da hängen an einem Ast eher einmal ein Dutzend kleine Mangos als eine ordentliche. Und vom anderen Nachbarn wachst der Brotfruchtbaum herüber.

Paradiesische Zustände? Na ja, nicht wenn ich mir von den Ärztinnen über den Zustand des Gesundheitsbewusstseins auf der Insel erzählen lasse. Und wie das polynesische Gesundheitssystem nicht das Niveau des französischen hat. Oder von der Sozialarbeiterin Bilder gezeigt bekomme, wozu auch auf Tahiti soziale Isolation führt. Meine Probleme sind zugegebenermaßen etwas weniger dringend und tendenziell insektenbezogen. Die Gelsen sind recht eine Plage, meine Füße sind mit Bissen übersäht und heute bin ich tatsächlich aufgewacht, weil mich eine in den Arm gestochen hat. Da hab ich mir schon gedacht, irgendwo hört sich der Spaß auf. Sonst checke ich halt jetzt im Bad noch bevor ich das Licht andrehe oder die Klodeckelposition ändere, ob da nicht eine Küchenschabe sitzt. Aber ja, insgesamt: bof.
Die meiste Aufregung hat uns die Nachbarskatze verschafft, weil sie ihre drei Kätzchen lieber bei uns großzieht als im Nachbarsgarten, wo ein Hund und eine Handvoll andere Katzen für Unruhe sorgen. So haben wir Katzenbabies bekommen: whoot! Letztens hat ihnen die Mutter eine halbe Ratte vorbeigebracht, nur dass ich das zuerst nicht erkannt hab und den Eindruck hatte, die spielen mit einem Kabel. Aber nein, die eine ist dann ein bisschen auf die Seite und dann hab ich gesehen, dass da Füße dran sind und überhaupt, dass an den zwanzig Zentimetern Rattenschwanz noch eine halbe Ratte dran hängt. Und in der Einfahrt liegen die Schwungfedern eines Finken (Lonchura castaneothorax), die ihm zuletzt wohl den notwendigen Aufschwung vorenthalten haben. Aber ur herzig. Und so unglaublich leicht, wenn man sie einmal zum Hochheben erwischt. Mittlerweile sind sie zwei von dreien auch schon vercheckt und wahrscheinlich haben sie da ziemlich ein Glück, mit dem Leben davongekommen zu sein.

Wer will noch was zur Vogelwelt lesen? Die „Honigfresser“, die mir in Australien so ein Novum gewesen sind, hab ich bisher echt in jedem Land gefunden, das ich seit dem besucht habe. Noch dazu schauen sie sich von Sumatra bis Tahiti relativ ähnlich und ich erinnere mich, schon mit dem einen in Australien Bestimmungsschwierigkeiten gehabt zu haben. Also zurück an den… Identifikationstisch. Und ich bin natürlich jetzt überhaupt nicht sicher, was ich damals gesehen habe. Aber was ich nicht bestimmt hab und sicherlich auch in Tin Can Bay gesehen hab, das ist der Hirtenmaina. Ich mein, den Namen hätten wir uns gemerkt. Aber das macht natürlich Sinn, weil der als extrem invasive Spezies beschrieben wird, nicht nur im Durchsetzen sondern auch im absichtlich Aussetzen. Also: Common Myna. Schaut jetzt nicht ur wie ein Hongfresser aus, hätte ich ein Bild gehabt, wäre das wohl schnell einmal aufgeklärt gewesen.
Außerdem gibt s diese kleinen Tauben, Sperbertaube (Geopelia striata). Dabei dürfte ich, nur weil sich s anbietet, in Australien das Friedenstäubchen (Geopelia placida, der deutsche Name ist ja wohl etwas herablassend) richtig bestimmt haben. Nah verwandt auf jeden Fall, die deutsche Wikipedia sagt, manche AutorInnen sehen in ihr eine Unterart der Sperbertaube. Die englische Wikipedia wiederholt diese Aussage und ergänzt until recently. Die Tauben laufen auf jeden Fall viel am Boden herum, was mir gut gefällt, weil es meine Dinosaurierassoziation erleichtert. Dann gibt s noch diesen Finken, von denen die Katzenmutter einen erledigt hat. Und den Rußbülbül (Pycnonotus cafer), der sich auch wiederum vor allem dadurch hervortut, dass er als extrem invasiv beschrieben wird. Und ich hab noch gedacht, schau, was für ein schöner einheimischer Vogel. Aber vor allem gibt s Unmengen von Hühnern. Zumindest auch nicht einheimisch, wenn schon nicht invasiv in dem Sinn. Invasiv vielleicht in meinen Schlaf, das schon, ich wach tatsächlich immer noch mit dem Hahnenschrei auf. Aber ich steh nicht auf sondern schlaf weiter, weil das ist üblicherweise etwas zu früh. Aber schon schön, die Hähne, wie die glänzen und schillern. Und wild, die Krallen.

Ich bin immer noch nicht in Pape’ete gewesen, aber ich gehe regelmäßig die Straße hoch zur Marina für meine Tauchstunden. Und dort sitzen immer wieder Leute, die Mangos, Ananas und Honig in Flaschen verkaufen. Wobei ich selbst auch immer wieder mal eine ordentliche Mango einfach auf der Straße finde, weil die dort vom Baum gefallen ist. Und dafür, dass die hier so aufklaubbar sind, finde ich die vier Euro, die dafür verlangt werden, doch ein bisschen heftig. Interessant übrigens, dass in der Bevölkerung das Blumen-im-Haar-Tragen total wirklich praktiziert wird. Es gibt im Supermarkt auch künstliche, die man sich ins Haar spangerln kann, aber nachdem überall die großzügigsten Blüten sprießen sind s in der Regel doch wohl meistens echte.
Zur Marina rauf ist es eine knappe Stunde. Und dann wieder eine Stunde runter, aber das ist meine Bewegung. Komisch eigentlich, dass ich mir denke, dass es für einen echten Ausflug ins Landesinnere einfach zu heiß sei, ich aber trotzdem meinen Weg marschier. Es gabert sogar einen Bus, aber das erschien mir bisher tatsächlich als der größere Aufwand herauszufinden, wie der funktioniert. Dafür hab ich letztens mit einem Sonnenbrand bezahlt. Nämlich den Sonnenbrand im Gesicht. Den Sonnenbrand am Rücken hab ich mir in den zehn Minuten geholt, in denen ich mit nacktem Oberkörper am Boot gesessen bin, mit dem wir zu unserer Tauchstelle gefahren sind. (Sagt man gefahren für ein Boot?) Danach hab ich den Anzug zugezippt und die Sonne hat quasi keine Chance sonst irgendwann zu meiner zarten Engerlinghaut durchzudringen.
Oh, aber Tauchen! Ich war jetzt dreimal in der Lagune tauchen und einerseits versteh ich ein bisschen besser, was eine Lagune ist, und wie das in echt ausschaut, was komisch ausschaut, wenn man s auf einer Landkarte sieht und zweitens ist das schon unglaublich. Es ist nämlich wirklich unglaublich. Allein die Farbe, die das Meer hat. Ich war erst ein wenig perplex, bis die eine Taucherin meinen Blick gesehen hat und gemeint hat, es sei wohl wie ein Swimming Pool. Ich war ein wenig sprachlos auf der Suche nach einem Vergleich und dieser kam mir etwas banal vor. Aber es stimmt halt trotzdem: Das Meer ist da etwa sechs Meter tief und es hat eine Farbe wie Schlumpfeis. Das Wasser ist so klar, dass am Boden das Licht tanzt. Und so wie an den Straßenränder Zimmerpflanzen wuchern, so schwimmen schon im Yachthafen die Aquarienfische herum. Und natürlich die paar hundert Meter, die ich bisher draußen gewesen bin: mehr Aquarienfische. Insofern hab ich in meinem Tauchbuch unter der Ortsbezeichnung dann auch L’Aquarium hingeschrieben. Wobei das mehr die kontrollierten Umstände beschreibt, unter denen ich dort atmen lerne.
Das ist erstaunlich schwer. Selbst wenn ich meine Erfahrungen jetzt auch schon jenseits der Lagune sammle, so zu atmen, dass ich in einer Ebene bleibe, ist nach wie vor die größte Herausforderung. Immerhin hab ich die leichte Panik abgelegt, die mich anfangs bei dem Gedanken, dass ich zehn, zwanzig Meter unter Wasser für eine halbe Stunde und länger aus einer Flasche atme, durchflutet hat. Dieser eher theoretische Gedanke wird relativ schnell von der Praxis eingeholt, wo man einfach merkt: Es geht halt. Und jetzt sammle ich dann ein bisschen Fische: Noch bevor ich das allererste Mal unter Wasser getaucht bin, hab ich schon einen Stachelrochen durchs Wasser hab huschen sehen. Kurz darauf ist uns ein interessanter, aber mir mir im Nachhinein unbestimmbarer Fisch über den Weg und den Lagunenboden gekrabbelt. Am Tag darauf haben wir dann einen Feuerfisch aufgespürt, der sich in einem Riff versteckt hat. Aber dann raus aus der Lagune ist schon nochmal was anderes, allein weil wir in einer halben Stunde vier Schildkröten getroffen haben und das ist schon was ziemlich cooles.

Sonst tu ich mir zum Beispiel noch ziemlich schwer, einmal unter Wasser, TaucherInnen von einander zu unterscheiden, aber insbesondere verschwimmen (haha!) mir die TauchlehrerInnen leicht einmal alle in zirka die gleiche Person. Nicht nur, dass die LehrerInnen in den Anschauungsvideos (die ich mir mit ZeugIn bestätigen musste, angesehen zu haben) genauso ausschauen, wie die in echt, ich hatte auch gestern einen anderen als heute, aber unter Wasser, hinter der Brille, mit dem Luftschlauch im Mund schauen sie alle bisschen gleich aus. Und von der Gestik her gibt s auch nicht viel Spielraum, nachdem alle Bewegungen zur Kommunikation mit großer Deutlichkeit gemacht werden. Darin muss irgendwo der Grund liegen, warum Taucherbrillen in Neonfarben auch für Erwachsene zu haben sind.
Insgesamt bin ich von der ganzen Eine-Neue-Fertigkeit-Erlernen fasziniert. Einerseits einfach, weil ich einer Didaktik ausgesetzt bin, weil ich Sachen gesagt und gezeigt bekomme, die ich dann wiederhole und später nochmal abgefragt werde. Aber auch weil es nicht in erster Linie kopfig ist sondern von mir Körperkontrolle oder halt Gestaltung von Muskelgehirn verlangt. Und auch, wo man ein bisschen in eine Gemeinschaft eingeführt wird, die ihre eigene Sprache und Gestik, ihre eigenen Werte und Bedeutungen mit sich bringt. In diesem Zusammenhang kann ich vielleicht auch feststellen, dass ich meine schicken Schwimmbadehosen letztens heimgeschickt habe. Aber jetzt vermiss ich sie fast. Einerseits sind die Franzosen wohl einfach ein bisschen näher an der Spandex-Badehose-Kultur als die Anglophonen, aber es ist auch eine Frage des In-den-Anzug-Hineinkommens.
Auf der anderen Seite erlebe ich die Verantwortung, die ich dabei für mich übernehmen muss als eine große Herausforderung. Also, nicht „Herausforderung“-Herausforderung. Aber es war ein bisschen unerwartet, als ich gestern meine Ausrüstung gecheckt hab, meine Luft und meinen Druck und dass alles richtig angeschlossen ist und funktioniert. Und es dass dann gewesen ist, der eine Anleiter hat mich gefragt, ob ich dieses und jenes gecheckt hab und ich sag ja. Und er sagt passt. Und das war s dann. Da hab ich ein bisschen gemerkt, ja, ich tu das nicht, damit ich die Checklisten in der richtigen Reihenfolge durchgehe, die ich am Tag davor gelernt hab. Sondern ich tu das, damit meine Sachen gecheckt sind, weil jetzt dann mein Leben davon abhängt, dass das Gerät mir erlaubt, unter Wasser zu atmen. Ich mein, ja, so schlimm ist es jetzt noch nicht, aber es hat einen Unterschied gemacht und ich hab ein bisschen gemerkt, dass ich immer noch ein bisschen mehr lern, weil s gelernt gehört und nicht, sagen wir mal: mit Anwendungsorientierung.
Auch sonst merke ich im übrigen die Abnutzungserscheinungen an meinen Gerätschaften. Innerhalb der letzten Woche hat mir in einem T-Shirt der Stoff der Belastung (Dauernutzung, Wäschetrockner) nachgegeben, das Leder meiner Waldviertler reißt an verschiedenen Stellen durch und heute sind hat sich mein linker Kopfhörer verabschiedet. Auf der anderen Seite bin ich grad bisschen viel mit Administration von meinem daheimgelassenen Leben beschäftigt und höre regelmäßig mal den Falter Podcast oder ein Ö1 Journal. So bin ich grad in einem relativ regelmäßigen Leben, wo ich Termine hab und wo ich zumindest via proxi einen Rhythmus von Arbeit und Wochenende erlebe. Hingegen erlebe ich auch den Bezug zu Österreich gerade etwas intensiver, auch wenn (oder weil) sich manches davon langsam auflöst, wenn s auch nur ein Schuh ist, der sich Stück für Stück verabschiedet.

Zf1G (8)
I’m taking diving classes on Táhití.
On a boat, in my trunks, crossing the sea
On the way to the site
The sun shone too bright
And burnt my pale upper bodý.